Transportwiderstand begrenzt Effizienz organischer Solarzellen
Unter Federführung der TU Chemnitz beschäftigt sich ein Forschungsverbund seit 2023 mit der technischen Optimierung von gedruckten Solarzellen. Jetzt veröffentlichten die Beteiligten neue Zwischenergebnisse.
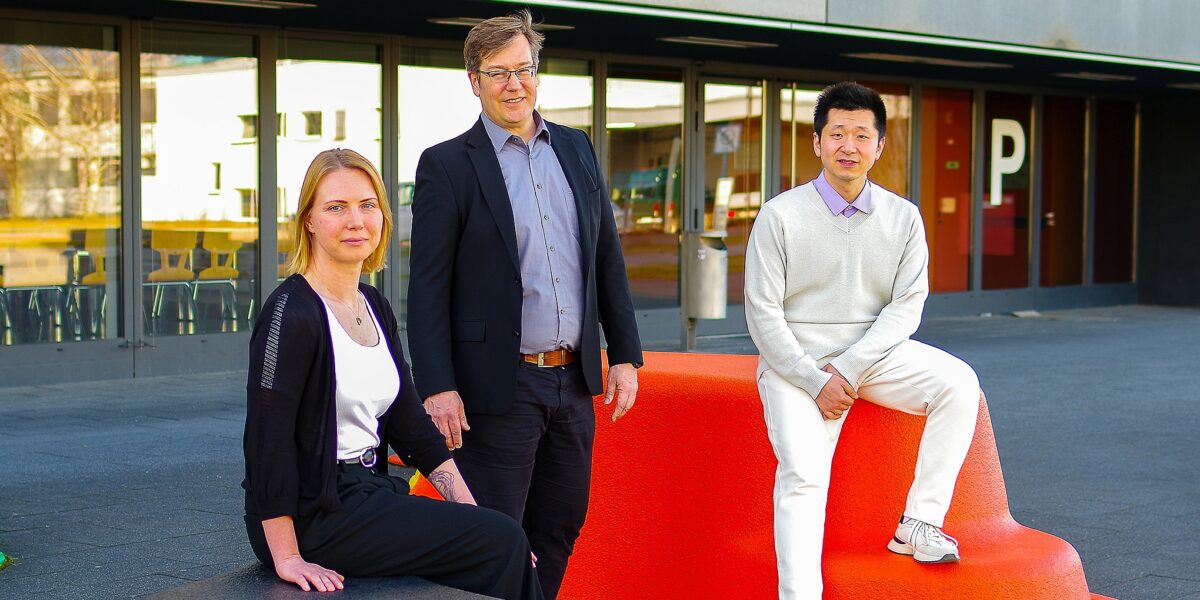
Stellten die neuen Forschungsergebnisse vor (v.l.): Maria Saladina, Professor Dr. Carsten Deibel und Chen Wang von der Professur Optik und Photonik kondensierter Materie der TU Chemnitz.
Foto: Martin Mellendorf
Organische Solarzellen gehörten in den vergangenen Jahren zu den vielversprechendsten Entwicklungen in der Solarbranche: Die auch als Plastik- oder Kunststoffsolarzellen bezeichneten Solarzellen werden aus verschiedensten Kohlenwasserstoffverbindungen gefertigt, die Produktionskosten sind vergleichsweise gering. Das liegt einerseits daran, dass entsprechende Kunststoffe recht günstig hergestellt werden können. Außerdem werden keine Hochtemperaturverfahren und aufwendige Reinigungen zur Herstellung der Solarzellen benötigt. Die Solarzellen werden einfach im Rolle-zu-Rolle-Verfahren auf ein Trägermaterial aufgedruckt. Wenngleich mehrere Hersteller mittlerweile Solarmodule mit organischen Solarzellen im Programm haben, sind längst (noch) nicht alle Nutzungsmöglichkeiten der Technologie erschlossen.
Internationale Forschungsgemeinschaft zu organischer Photovoltaik
In Chemnitz forscht man seit Jahren zu dem Thema: Im Dezember 2022 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die Einrichtung der Forschungsgruppe „Gedruckte & stabile organische Photovoltaik mit Nicht-Fullerenakzeptoren – POPULAR“ beschlossen. Aktuell daran beteiligt sind 14 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehrerer Universitäten in Deutschland und Großbritannien. Sprecher des mit rund fünf Millionen Euro geförderten Projektes ist Professor Dr. Carsten Deibel. Das Team der von ihm geleiteten Professur „Optik und Photonik kondensierter Materie“ arbeitet mit den Partnerinstitutionen intensiv an Solarzellen aus neuartigen organischen Halbleitern, die mit etablierten Druckverfahren produziert werden können.
Transportwiderstand führt zu geringerer Leistung
„Organische Solarzellen können sehr einfach und günstig mit Druckverfahren hergestellt werden“, sagt Deibel. Im Gegensatz zu etablierten Solarmodulen aus kristallinem Silizium sei der Stromfluss in den organischen Solarzellen aber sehr langsam. „Durch die Herstellung der Solarzellen aus einer Art Tinte sind die organischen, lichtabsorbierenden Schichten sehr ungeordnet. Daher ist der Stromfluss sehr langsam“, erläutert der Wissenschaftler. Eine Folge des langsamen Transports der durch Licht erzeugten Ladungsträger ist der sogenannte Transportwiderstand, der den Füllfaktor der Solarzellen und damit die Leistung verringert.
„Ladungsträger stehen sich selbst im Weg“
Um die Leistungscharakteristik von organischen Solarzellen besser zu verstehen, haben Deibel und seine Wissenschaftliche Mitarbeiterin Maria Saladina verschiedene Arten von organischen Solarzellen hergestellt, detailliert untersucht und den negativen Einfluss des Transportwiderstands aufgedeckt. Dabei wurden die Strom-Spannungskennlinien unter Beleuchtung, die sich aus dem Wechselspiel aus Ladungsgeneration aus Licht, der Rekombination dieser Ladungsträger und ihrem Transport zu den Elektroden ergeben, gemessen.
Diese enthalten die Informationen zur Leistungseffizienz der Solarzellen. Die Strom-Spannungskennlinien wurden mit der sogenannten suns-Voc-Methode verglichen. Diese Methode erlaubt anhand der Messung der Leerlaufspannung unter verschiedenen Beleuchtungsintensitäten, eine alternative Strom-Spannungskurve zu konstruieren, die nicht durch Ladungstransportverluste wie den Transportwiderstand limitiert sind. „Der Transportwiderstand ist ein Resultat der langsamen Ladungsträger in den ungeordneten – aus organischer Tinte prozessierten – Solarzellen. So stehen sich die Ladungsträger selbst im Weg und führen zu einem Verlust von Füllfaktor und damit Leistung“, erklärt Saladina.
Wachsendes Verständnis für die physikalischen Grundlagen
Obwohl die Optimierung organischer Solarzellen wegen dieser neuen Ergebnisse neu bewertet werden müsse, gebe es kein grundsätzliches Hindernis, um hocheffiziente, gedruckte organische Solarzellen zu fertigen, resümieren die Forschenden in einem in der Fachzeitschrift „Reports on Progress in Physics“ erschienenen Bericht. In dem Perspektiv-Artikel werden der physikalische Ursprung des Transportwiderstands und die Bedeutung für Solarzellen genau erklärt. „In den letzten Jahren ist der Ladungstransport immer weiter verbessert worden, ohne dass in der Forschergemeinde der genaue Zusammenhang zwischen Füllfaktorverlusten und Transportwiderstand genauer bekannt war“, sagt Deibel. Saladina ergänzt: „Neben der Rekombination wird auch der Transportwiderstand durch die Form der Zustandsdichte der organischen Solarzellen bestimmt. Das zeigt, dass wir Schritt für Schritt die physikalischen Grundlagen dieser photovoltaischen Bauelemente immer besser verstehen.“
Ebenfalls interessant:
- Analyse zur CO2-Speicherung unter der Nordsee vorgestellt
- Stromspeicher: Wie die Effizienz gesteigert werden kann
- Baukonjunktur: Hoffnung auf positive Impulse erst in 2026
- Umfrage: Immobilienbesitzer zufrieden mit ihrer Wärmepumpe
- Energy Lab: KIT erweitert Forschungsinfrastruktur
- Leistung bei PV-Modulen häufig zu hoch angegeben
- Reallabor für Rheinisches Revier











