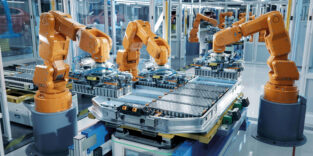Kreislauffähige Produkte entwickeln und produzieren
Schwerpunktprogramm „Hybride Entscheidungsunterstützung in der Produktentstehung“ unter der Leitung der Universität Paderborn gestartet.

Auftaktveranstaltung zum Projektstart in Paderborn.
Foto: Universität Paderborn, Heinz Nixdorf Institut
Heutige technische Systeme sind interdisziplinär, komplex und miteinander vernetzt. Neben der hohen Produktkomplexität müssen die Forderungen nach Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit erfüllt werden. Doch wie gelingt dies bei Produkten, die nicht nur heute, sondern auch in vielen Jahren den Prinzipien der nachhaltigen Ressourcennutzung gerecht werden sollen? Bereits während der Entwicklung müssen Ingenieurinnen und Ingenieure Entscheidungen treffen, die den gesamten Lebenszyklus eines Produkts beeinflussen – von der ersten Idee über die Nutzung bis zur Rückführung.
Grundlagenforschung zum Einsatz von Data Science und KI in der Produktentstehung
Um die Leistungsfähigkeit der interdisziplinären Produktentstehung zu erhöhen, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unter der Leitung der Universität Paderborn das Schwerpunktprogramm „Hybride Entscheidungsunterstützung in der Produktentstehung“ gestartet. So sollen die komplexen Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft, globaler Abhängigkeiten und der digitalen Transformation im Maschinen- und Anlagenbau gemeistert werden. Im Kern betreiben die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Grundlagenforschung zum Einsatz von Data Science und künstlicher Intelligenz (KI) in der Produktentstehung. Das Schwerpunktprogramm umfasst sechs Forschungsprojekte, die durch insgesamt elf Universitäten und mehr als 40 Forscherinnen und Forscher aus ganz Deutschland bearbeitet werden. Sie werden über eine Dauer von zunächst drei Jahren mit rund sechs Millionen Euro gefördert.
Herausforderungen in der Produktentstehung meistern
Prof. Dr.-Ing. Iris Gräßler, Leiterin der Fachgruppe Produktentstehung am Heinz Nixdorf Institut (HNI) der Universität Paderborn, koordiniert das Schwerpunktprogramm. Sie erläutert: „In den Projekten erforschen wir, wie wir durch die systematische Einbeziehung von Daten und KI Herausforderungen im Bereich der Produktentstehung überwinden können.“ Eine besondere Schwierigkeit liegt in der Verfügbarkeit der auszuwertenden Daten. Diese liegen mitunter in sehr großen Mengen, in unterschiedlichen Formaten und Sprachen, von verschiedenen Quellen oder in lückenhafter Form vor.
„Data Science und KI sollen menschliche Fähigkeiten in etablierten Verfahren der Ingenieurwissenschaften erweitern.“
Ziel des Schwerpunktprogramms ist es, derart extreme Daten in Form von hybrider Entscheidungsunterstützung zu nutzen. „Data Science und KI sollen menschliche Fähigkeiten in etablierten Verfahren der Ingenieurwissenschaften erweitern. Mit den Erkenntnissen, die wir anstreben, soll es in Zukunft möglich sein, außer Betrieb genommene Produkte auf einem höchstmöglichen Zirkulariätsniveau in den Produktlebenszyklus zurückzuführen und Anforderungen an Produktionsstätten abzuleiten“, so Gräßler. Das Zirkularitätsniveau quantifiziert, wie effizient Ressourcen innerhalb eines geschlossenen Kreislaufs genutzt, wiederverwendet und recycelt werden, um Abfall zu minimieren und den Abbau neuer, endlicher Ressourcen zu reduzieren.
Projektbeispiel am HNI: „Design for Capabilities“ (DeCap)
Im Projekt „DeCap – Fähigkeitsgerechte Produktentstehung“, das Teil des neuen Schwerpunktprogramms ist, untersuchen Forscherinnen und Forscher des Paderborner HNI und des Instituts für Fabrikanlagen und Logistik der Leibniz Universität Hannover, wie bestehende Fähigkeiten in der Produktion bereits während der Entwicklung berücksichtigt werden können. Sie erfassen Daten aus dem Produktionsumfeld, werten diese automatisiert aus und leiten daraus Fähigkeitsprofile ab. Damit können Ingenieurinnen und Ingenieure zukünftig Produkte so entwickeln, dass diese nicht nur einmalig montiert, sondern auch demontiert und wiederverwendet werden können. Eine besondere Herausforderung stellt in diesem Forschungskontext die Demontage mit dem Ziel der Remontage dar, weil es schwierig ist, den Produktzustand, konkrete Aufgaben und erforderliche Fähigkeiten vorab zu planen.
Produktgestaltung: Wiederverwendbarkeit von Beginn an im Blick
Gräßler gibt ein Beispiel: „Stellen wir uns ein Mountainbike mit Carbon-Gabel vor, das sportlich im Gelände gefahren und irgendwann ausrangiert wird. Kann ausgeschlossen werden, dass das Fahrrad einen schweren Sturz erlebt hat? Eine Carbon-Gabel müsste aufwendig untersucht werden, während eine Gabel aus Stahl viel einfacher wiederverwendet werden könnte.“ Zur Einordnung: Im Gegensatz zu Stahl, bei dem Verformungen oder Risse meist direkt sichtbar oder leicht erkennbar sind, können in Carbon-Materialien Mikrorisse oder innere Strukturschäden entstehen, die das bloße Auge nicht erfassen kann. „Unser Ziel ist es, zukünftig das Fahrrad von Beginn an so zu gestalten, dass die Einzelteile einfach wiederverwendet werden können“, erklärt Gräßler.
Die Gruppen der Forschenden und die Forschungsziele
Neben der Universität Paderborn sind
- die RWTH Aachen,
- die TU Berlin,
- die Ruhr Universität Bochum,
- die TU Chemnitz,
- die Leibniz Universität Hannover,
- die RPTU Kaiserslautern,
- die Universität Trier
- und das Karlsruher Institut für Technologie
an den Forschungsprojekten des Schwerpunktprogramms beteiligt. Sie untersuchen sogenannte „Machine Learning Ersatzmodelle“ (MLS), um herkömmliche Simulationen für Produktanalyse und -validierung zu verbessern oder teilweise zu ersetzen. Oder sie ermöglichen eine ressourceneffiziente Optimierung für die notwendige Re-Konfiguration bestehender Montagesysteme. Zudem vereinfachen sie Designprozesse und unterstützen Ingenieurinnen und Ingenieure bei der Anforderungserfüllung. Eine weitere Gruppe entwickelt ein multimodales KI-System, um aufgabenspezifische Entscheidungsaktivitäten hinsichtlich spezifischer Anwendungsfälle zu unterstützen. Dafür verarbeitet sie komplexe Datensätze. Und auch in Produktionsphasen werden Optimierungspotenziale abgeleitet, damit diese im Designprozess als Entscheidungsunterstützung nutzbar sein können.
Weitere Informationen zum Schwerpunktprogramm gibt es unter: https://www.spp2443.de/