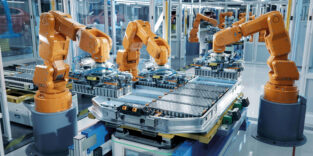Plastikmüll im Ozean: Wie biologisch abbaubare Kunststoffe der dritten Generation zur Lösung beitragen können
Biologisch abbaubare Kunststoffe der dritten Generation könnten ein entscheidender Hebel gegen die globale Plastikverschmutzung in Meeren sein. Forschende des ZMT setzen dabei auf das EU-Konzept „Safe and Sustainable by Design“ – mit Potenzial für nachhaltige Materialinnovationen.

Schätzungsweise drei bis fünf Prozent des weltweit produzierten Plastiks landen in der Umwelt. Biologisch abbaubare Kunststoffe sollen zur Lösung dieses Problems beitragen. Forschende des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung (ZMT) setzen dabei auf biologisch abbaubare Kunststoffe der „dritten Generation“, die - basierend auf dem EU-Konzept ‚Safe and Sustainable by Design‘ (SSbD) - entwickelt werden sollen.
Foto: PantherMedia / Federico Caputo
Seit über zwei Jahren verhandeln die UN-Mitgliedstaaten über ein internationales Plastikabkommen zur Eindämmung der globalen Plastikflut. Die nächste Verhandlungsrunde findet im August 2025 in Genf statt. Ziel ist ein verbindlicher Vertrag mit global wirksamen Maßnahmen gegen die wachsende Plastikverschmutzung. Forschende des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung (ZMT) haben bestehende Strategien zur Bekämpfung von Plastikmüll analysiert und präsentieren zusätzliche Lösungswege, wie das Problem der Kunststoffbelastung in marinen Ökosystemen wirksamer adressiert werden kann.
Dabei stehen biologisch abbaubare Kunststoffe der dritten Generation im Fokus – Materialien, die nach dem EU-Konzept „Safe and Sustainable by Design (SSbD)“ entwickelt werden sollen. Die Ergebnisse dieser umfassenden Analyse wurden im Fachjournal Sustainable Chemistry and Pharmacy veröffentlicht.
Elektronisch leitfähiger Druck als Schlüsseltechnologie für smarte Textilien
Plastikproduktion, Umweltfolgen und globale Herausforderungen
Im Jahr 2022 erreichte die weltweite Kunststoffproduktion 400 Mio. t, von denen 3 bis 5 % in der Umwelt landen. Diese Mengen wirken sich katastrophal auf marine und terrestrische Ökosysteme aus. Neben der Bedrohung für Tierwelt und Biodiversität sind auch Tourismus, Fischerei und menschliches Wohlergehen massiv betroffen. Ein zentrales Problem: Rund zwei Milliarden Menschen – vor allem in tropischen Regionen – sind nicht an funktionierende Abfallentsorgungssysteme angeschlossen.
In der Umwelt zerfällt Plastik nicht vollständig, sondern bildet Mikro- und Nanoplastik, das über Jahrzehnte hinweg bestehen bleibt. Die zunehmende Verschmutzung der Meere mit Kunststoffabfällen zählt inzwischen zu den größten globalen Umweltproblemen. Das Unterziel SDG 14.1 der UN-Nachhaltigkeitsagenda fordert eine drastische Reduktion der Meeresverschmutzung bis 2025 – doch ein Ende der Plastikflut ist derzeit nicht absehbar. Selbst bei sofortigen Maßnahmen könnten laut Prognosen bis 2040 über 700 Mio. t Plastikabfall in die Umwelt gelangen.
Baustoffe zirkulär nutzen: Neue Datengrundlage für ressourcenschonendes Bauen
Bestehende Strategien reichen nicht aus – frühzeitiger Ansatz in der Materialentwicklung
Die ZMT-Forschenden Rebecca Lahl und Raimund Bleischwitz haben verschiedene politische, technische und gesellschaftliche Maßnahmen zur Eindämmung des Plastikmülls untersucht. Dabei nahmen sie unter anderem das Abfallmanagement in der Kreislaufwirtschaft, technologische Ansätze zur Meeresreinigung, erweiterte Herstellerverantwortung und Aufklärungskampagnen in den Blick. „Diese Maßnahmen müssen weiterhin umgesetzt und ausgebaut werden, sie reichen aber nicht, um das Plastikproblem zu bewältigen“, so Rebecca Lahl. „Unser Lösungsvorschlag setzt viel früher an – nämlich bei der Entwicklung der für die Plastikproduktion eingesetzten Chemikalien und Materialien.“
SSbD als Konzept für biologisch abbaubare Kunststoffe der dritten Generation
Die ZMT-Studie schlägt vor, biologisch abbaubare Kunststoffe nach dem EU-Leitbild Safe and Sustainable by Design (SSbD) zu entwickeln. Dieses Konzept ist Bestandteil des European Green Deals und verfolgt das Ziel, nachhaltige Chemikalien, Materialien und Produkte entlang ihres gesamten Lebenszyklus sicher zu gestalten – von der Herstellung bis zum Recycling oder Abbau. Insbesondere Kunststoffe, die unweigerlich in die Umwelt gelangen, etwa als Mikroplastik oder Verpackungsreste, müssen durch neue Materialien ersetzt werden. „Biologisch abbaubare Kunststoffe nach SSbD-Kriterien bieten Innovationsperspektiven und können eine zusätzliche Strategie zur Bewältigung des Plastikmülls in den Ozeanen, aber auch an Land sein“, betont Rebecca Lahl. Raimund Bleischwitz ergänzt: „So können neue Materialien geschaffen werden, die von Natur aus sicher für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind und gleichzeitig die langfristige ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit fördern.“
Metamaterialien mit spiralförmiger Torsion speichern enorme Mengen Energie
Rückblick: Generationen biologisch abbaubarer Kunststoffe im Vergleich
Die Forschenden sprechen im Zusammenhang mit dem SSbD-Ansatz von einer „dritten Generation biologisch abbaubarer Kunststoffe“. Frühere Entwicklungsansätze scheiterten häufig an mangelnder Praxistauglichkeit. „Der größte konzeptionelle Fehler bestand zu jener Zeit darin, bei den Polymeren der ‚ewigen‘ Kunststoffe zu bleiben. Und dann wurden sie zu früh und ohne ausreichende Validierung durch Abbaubarkeitstests auf den Markt gebracht und als Lösung des Plastikproblems kommuniziert“, erklärt Raimund Bleischwitz zur ersten Generation. Die zweite Generation biologisch abbaubarer Kunststoffe orientierte sich an natürlichen Polymeren wie Proteinen, Polysacchariden oder Naturkautschuk, die sich langfristig biologisch abbauen lassen. „Die Natur stand Pate für diese ‚zweite Generation‘ biologisch abbaubarer Plastikprodukte“, so Rebecca Lahl.
Doch obwohl sie einen Fortschritt darstellen, machen diese Materialien derzeit nur rund 0,5 % des weltweiten Kunststoffmarkts aus. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, müssen künftige Materialien ausreichend stabil in der Gebrauchsphase sein und sich zugleich in angemessener Zeit in der Umwelt abbauen.
Smarte Folien und Textilien setzen neue Maßstäbe in der Aktorik
Anwendungspotenziale: Zehn priorisierte Kunststoffgruppen für SSbD-Innovationen
Die ZMT-Studie schlägt vor, zukünftige biologisch abbaubare Kunststoffe vorrangig dort einzusetzen, wo eine Freisetzung in die Umwelt unausweichlich ist. Hierzu gehören insbesondere:
- Mikroplastik in Kosmetika, Reinigern oder Pflegeprodukten
- Mikroplastik in Farben, Lacken und Dichtstoffen
- Gummiabrieb durch Gebrauch (z. B. Reifenpartikel)
- Abriebintensive Artikel wie Schwämme oder Putztücher
- Landwirtschaftliche Produkte wie Mulchfolien und Saatgutverpackungen
- Fischfangartikel wie Schleppnetze
- Textilien für Wasserkontakt (z. B. Bademode)
- Kleinteile wie Hüllen von Feuerwerkskörpern
- Kunststoffverpackungen für Lebensmittel
- sonstige Einwegartikel (z. B. Zigarettenfilter)
Ziel ist es, diese Anwendungen durch SSbD-konforme Materialien zu ersetzen, die am Ende ihres Lebenszyklus umweltverträglich abgebaut oder recycelt werden können.
VDI-Nachhaltigkeitspreis Kunststofftechnik 2025
Regulierungsimpuls als Innovationsmotor: Von der Norm zur Praxis
Ein zentrales Element des Vorschlags ist der regulatorische Vorstoß als Ausgangspunkt für Innovationen. „Es gibt viele Beispiele, vor allem auf EU-Ebene, bei denen Innovationen durch ehrgeizige Standards erst angestoßen wurden. In der Vergangenheit wurden etwa für Industrieanlagen oder Autos Emissionsgrenzwerte festgelegt, für die die notwendige Technik erst nachträglich entwickelt wurde“, so Raimund Bleischwitz. Rebecca Lahl ergänzt: „Eine einfache Folie zur Verpackung von Fleisch oder Käse besteht heute aus mehreren verschiedenen Schichten, die diese Folie zu einem Hightech-Produkt machen. Auf dieses neue Gestaltungspotenzial setzen wir.“
Der vorgeschlagene Weg sieht also vor, klare Anforderungen an die Abbaubarkeit und Sicherheit neuer Kunststoffe zu definieren, um damit die Entwicklung einer neuen Generation umweltverträglicher Materialien gezielt zu fördern.