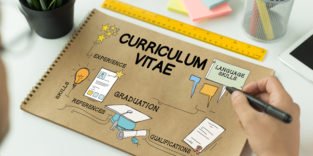So viel Rente bekommen Schweden, Schweizer und Holländer
Die Schweiz, Schweden und die Niederlande zahlen deutlich höhere Renten zu geringeren Beitragssätzen. Ein Vorbild für Deutschland?

Entspannt zurücklehnen können sich die Niederländer im Alter. Sie bekommen rund 80 % ihres vorigen Gehalts als Rente. In Deutschland garantiert die staatliche Rente nur 48 %.
Foto: PantherMedia / ljsphotography
Inhaltsverzeichnis
Es ist wieder so weit: Der demografische und finanzielle Druck auf das Rentensystem in Deutschland ist erneut so groß, dass die Bundesregierung Anpassungen vornehmen muss. Die Entscheidungen zur gesetzlichen Rente hat die Bundesregierung bereits getroffen. Das Rentenniveau soll auf 48 % des durchschnittlichen Arbeitseinkommens festgeschrieben werden. Die Kosten dafür bürdet die Bundesregierung via Umlageverfahren allein der erwerbsfähigen Generation auf, moniert Joachim Ragnitz von der Ifo Niederlassung Dresden. Und wörtlich: „Alle Altersgruppen, die jünger als 26 Jahre sind, gehören zu den Verlierern. Ihre zusätzlichen Beitragszahlungen übersteigen ihre zusätzlichen Rentenansprüche.“
Experten fordern Reform der Rente
Auch die zweite und dritte Säule des Systems will die Koalition in Berlin überarbeiten, also die betriebliche und die geförderte private Altersvorsorge. Laut Statistischem Bundesamt erwirbt nur gut jeder zweite sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland Ansprüche aus einer Betriebsrente. Die geförderte private Vorsorge, insbesondere die Riester-Rente, erreicht Fachleuten zufolge ihre Ziele überhaupt nicht. Reformvorschläge der Fokusgruppe liegen seit fast einem Jahr auf dem Tisch. Das Gremium empfiehlt der rot-grün-gelben Bundesregierung, die Fesseln, welche die rot-grüne Bundesregierung der Riester-Rente bei ihrer Einführung im Jahr 2002 angelegt hat, abzustreifen; das heißt vor allem eine Anlage in Aktien zu ermöglichen. Auch sonst sollen Aktien eine größere Rolle spielen. Dafür steht vor allem das vorgeschlagene staatlich geförderte Altersvorsorgedepot, das laut einer Umfrage auf großes Interesse stößt.
Rente: Schweden, Niederlande und Schweiz gelten als europäische Vorbilder
Andere Länder setzen längst auf die Chancen der Kapitalmärkte – und schaffen so zum Teil deutlich höherer Rentenleistungen als in Deutschland (siehe Tabelle: „Renten in ausgewählten Ländern“). Drei Beispiele sind die Niederlande, Schweden und die Schweiz. Deren Rentensysteme sollen im Folgenden näher beschrieben werden. Grundlage sind vor allem zwei Studien: Zum einen vom Institut für Wirtschaft und Gesellschaft (IWG) im Auftrag des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA), das vor allem vom Deutsche-Bank-Konzern getragen wird. Zum anderen die OECD-Publikation „Pension at a Glance 2023“. Erwähnt werden muss, dass die Strukturen in den Ländern historisch gewachsen sind und sich teils erheblich unterscheiden, was den direkten Vergleich erschwert. Gleichwohl ist ein Blick über die Grenze erhellend.
Niederlande: private Vorsorge kaum nötig
In den Niederlanden arbeiten Staat, Tarifpartner und Wirtschaft in der Sozialpolitik eng zusammen. Für die Altersversorgung bildet die umlagefinanzierte gesetzliche Rente die Basis. Die volle Rente erhält, wer 50 Jahre in den Niederlanden gewohnt hat – also auch, wenn keine Beiträge eingezahlt wurden. Sie beträgt 70 % des Nettomindestlohns von aktuell 2188,80 €/Monat (ab Alter 21 und bei 40-Stunden-Woche) bzw. 50 % bei Verheirateten. Sonstige Einkünfte werden nicht angerechnet. Seit 2024 beträgt das Renteneintrittsalter 67 Jahre. Es steigt mit der Lebenserwartung; dies gilt auch für Betriebsrenten.
Betriebliche Altersvorsorge ist Pflicht
Die betriebliche Altersvorsorge ist obligatorisch in Tarifverträgen enthalten; folglich erhalten prozentual viel mehr Niederländer eine Betriebsrente als Bundesbürger. Lange Zeit übernahmen Arbeitgeber die finanzielle Verantwortung für die Rentenversorgung; die Leistung für den Arbeitnehmer ist dann quasi garantiert. Seit Juli 2023 sind Pensionsfonds per Gesetz verpflichtet, zu beitragsbezogenen Systemen überzugehen. Hier hängt die Höhe der Rente stark vom Anlageerfolg am Kapitalmarkt ab.
Rentenniveau bei rund 80 %
Zuletzt erreichten die Niederländer ein Rentenniveau von 80 % aus den beiden Säulen gesetzliche und betriebliche Altersversorgung. Die private Vorsorge kommt obendrauf – „de Slagroom“, die Sahne, wie die Niederländer sagen. Eine Förderung hierfür erhält nur, wer keinen Anspruch auf Betriebsrente hat – zum Beispiel Selbstständige – oder dessen Rentenniveau unter 70 % bleibt. In Deutschland erhalten dagegen auch bzw. vor allem Gutverdienende eine Förderung, etwa durch die Rürup-Rente.
Schweden: Staatsfonds wirtschaftet mit den Einlagen
Das schwedische Alterssicherungssystem wurde vor rund 25 Jahren stark reformiert. Es gibt drei Pfeiler: umlagefinanzierte gesetzliche Rente, kapitalgedeckte Betriebsrente und privat geförderte Ansparungen.
Die gesetzliche Rente gilt für alle – auch für Beamte und Selbstständige. Ihre Höhe hängt ab vom Einkommen während des Arbeitslebens, der Demografie und dem Alter bei Renteneintritt. Ein Bezug ist mit großen Abschlägen ab 63 Jahren möglich. Generell darf jede Person trotz Rentenbezug weiterarbeiten. Erwerbstätige Rentenbezieher über 65 Jahre zahlen dann niedrigere Lohnsteuern und Sozialabgaben.
Der Staat berechnet die Rentenhöhe anhand einer Beitragsbemessungsgrenze. Arbeitgeber zahlen einen höheren Satz als Arbeitnehmer. In Summe beträgt der Beitragssatz 18,5 %. Laut IWG-Studie sind die Leistungen der umlagefinanzierten Rente relativ niedrig. Ist sie zu gering, greift die Grundsicherung und das Wohngeld.
Staatlicher Fonds erzielt knapp 10 % Rendite
Die Schweden zahlen 2,5 % aus der Bemessungsgrundlage in die Prämienrente ein, welche in Aktien und Anleihen investiert. Alle Einzahler können aus mehreren Fonds auswählen. Sofern keine Wahl getroffen wird, fließt dieser Beitrag in den staatlichen AP 7 Safa Fonds. Die Höhe der Prämienrente hängt von der Rendite des ausgewählten Produkts ab. Für Personen über 55 Jahren wird das Vermögen sukzessiv in festverzinsliche Papiere umgeschichtet. Laut Deutschem Aktieninstitut hat der AP 7 Safa in den letzten 20 Jahren eine Rendite von jährlich knapp 10 % erwirtschaftet.
Die betriebliche Altersvorsorge ist quasiobligatorisch. Die Abdeckung erreicht 90 %. Wie in den Niederlanden wandelt sich das System von einer leistungs- zu einer beitragsorientierten, meist kapitalgedeckten Zusage. Private Vorsorge erfolgt ohne Förderung. Nur Beiträge von Selbstständigen sind voll steuerlich absetzbar.
Schweiz: staatliche Minimalrente von knapp 1300 Euro
Laut IWG-Studie „war die staatliche Altersvorsorge in der direkten Demokratie der Schweiz viele Jahre ungewollt“. Erst 1947 wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen. Auch hier gibt es die drei bekannten Säulen: Die gesetzliche und die betriebliche (hier außer für Landwirte und Selbstständige) Altersvorsorge ist obligatorisch.
In der gesetzlichen Altersvorsorge zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils 4,35 % des Bruttolohns. Geringere Beiträge für Invaliditäts- und Ergänzungsleistungen kommen hinzu. Für Selbstständige richtet sich der Beitrag nach dem Einkommen und beträgt maximal 10 %. Wichtigster Unterschied zu anderen Ländern: Es gibt keine Beitragsbemessungsgrenze für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Bund beteiligt sich an den jährlichen Ausgaben der gesetzlichen Altersvorsorge.
Vier Jahrzehnte einzahlen für die Vollrente
Um eine Vollrente zu beziehen, müssen Männer 44 Jahre und Frauen 43 Jahre Beiträge auf ein Einkommen eingezahlt haben, das mindestens einem gewissen Mindestjahreseinkommen (2021: 86.040 Schweizer Franken, CHF) entspricht. Die staatliche Minimalrente betrug im Jahr 2021 rund 1195 CHF im Monat, die Maximalrente 2390 CHF. Ehepaare erhalten zusammen höchstens 150 % der Altersrente.
Der Zeitpunkt des Rentenbezugs kann – mit Abzügen – vorgezogen oder nach hinten verschoben werden. Ergänzungsleistungen decken beitragsunabhängig den Existenzbedarf, den die gesetzliche Altersvorsorge und weitere Einkünfte nicht decken.
Regulierte Bank- und Versicherungsprodukte
Die obligatorische kapitalgedeckte berufliche Vorsorge wurde bereits 1985 eingeführt. Geringverdiener sind de facto nicht oder nur gering über den Betrieb versichert. Landwirte und Selbstständige können sich freiwillig dem System anschließen. In der zweiten Säule gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze (2021: 86.040 CHF). Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich die Beiträge, wobei der Satz zwischen dem 25. bis 55. Lebensjahr kontinuierlich bis auf maximal 18 % steigt. Die Vorsorgeeinrichtungen garantieren auf den obligatorischen Teil eine Mindestrendite von 1 %. Zudem dürfen sie höchsten 50 % in Aktien investieren. Arbeitnehmer haben einen Anspruch auf Mitnahme des angesparten Kapitals bei einem Jobwechsel.
Für die private Vorsorge gibt es regulierte Bank- und Versicherungsprodukte: zum Beispiel „gesperrtes Konto“ und „gesperrte Police“. Beiträge hierfür können bis zu einer bestimmten Grenze steuerlich geltend gemacht werden.
Keine Beitragsbemessungsgrundlage
Wie der IWG-Studie zu entnehmen ist, stellen Experten das System in der Schweiz „grundsätzlich positiv dar“. Bei den Schweizern genieße es ein „großes Vertrauen“. Dies gelte auch für Gutverdiener, die einen „großen Solidarbeitrag“ – wegen der fehlenden Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Altersvorsorge – leisteten. In der Schweiz sei der Staat kein dominanter Akteur. Vielmehr lege er nur die Rahmenbedingungen fest und lasse der Wirtschaft und den Sozialpartnern große Freiheit.
Ein Beitrag von: