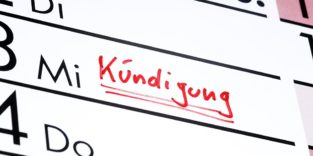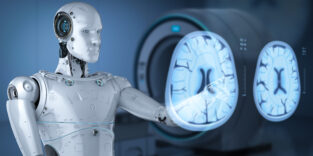Blutproben dürfen kein Standard bei Bewerbungsprozessen sein
Der potenzielle Arbeitgeber darf von zukünftigen Mitarbeitern Blutproben einfordern. Vornehmen darf er sie aber nur mit deren Zustimmung. Anders sieht es bei Personengruppen aus, von denen ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko ausgehen könnte. VDI nachrichten, Düsseldorf, 6. 11. 09, Fr
Mit Blutuntersuchungen bei Bewerbern hat die Stuttgarter Daimler AG unlängst für massive Empörung gesorgt. Der Konzern rechtfertigte sich damit, dass die Proben nur im Rahmen von Einstellungsgesprächen und zudem mit ausdrücklicher Einwilligung der Kandidaten entnommen worden seien. „Werksärztliche Untersuchungen finden erst im Zuge des konkreten Einstellungsprozesses statt, den jeder Bewerber vor oder nach einer endgültigen Zusage für die jeweilige Stelle durchläuft“, kommentierte Daimler-Sprecherin Nicole Kicherer.
Dazu müsse der Bewerber sein Einverständnis erklären. Rechtlich gesehen steht Daimler damit auf der sicheren Seite. Als Aufreger der Woche eignete sich die Meldung dennoch bestens. Dabei sind Bluttests schon vor der Einstellung in vielen Firmen gang und gäbe. Und das nicht erst in jüngster Zeit, sondern schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert.
In den USA gehört die Blutuntersuchung seit den 80er-Jahren zum Instrumentarium der Recruiter – ebenso wie das Assessment-Center, das Stressinterview und die Personendurchleuchtung im Internet. Geforscht wird aber nicht nur nach Anzeichen für eine Schwangerschaft, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Krebs und Infektionskrankheiten wie Aids. Seit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms lassen sich auch andere Erkrankungs- und damit Einstellungsrisiken entdecken.
Aus bestimmten Veränderungen der Genomstruktur können Mediziner und Biochemiker auf die Veranlagung für Hunderte von Erbkrankheiten schließen, darunter Sichelzellenanämie und Chorea Huntington, eine Form der Epilepsie. Offensichtlich werden auch die Risiken des Bewerbers, eines Tages an Bluthochdruck, Arterienverkalkung und Herzinfarkt zu erkranken. Und das ist für Jobs, die regelmäßig viel Stress mit sich bringen, keine günstige Voraussetzung.
Dass vor allem Chemie- und Pharmakonzerne großen Wert auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter legen, ist bekannt. Bei Beiersdorf und Merck gehören Blutuntersuchungen mit dem Einverständnis der Mitarbeiter, auch solcher in spe, zum Standard. Die BASF, so erschreckte der Chemielaborant Wolfgang Hien schon 1988 die Szene, untersuche seit Jahren systematisch die Erbanlagen ihrer Beschäftigten, um eventuelle Chromosomenschäden als Folge des Umgangs mit krebserregenden Stoffen zu orten.
Dabei stehe zu befürchten, argwöhnte Hien, dass die höchstwahrscheinlich angeborene Krankheitsbereitschaft des Menschen – seine „genetische Prädisposition“ – ins Spiel gebracht werde: Für manchen Mitarbeiter, aber auch schon für Jobaspiranten, könnte dies das vorzeitige „Aus“ bedeuten. Schwach konterte der damalige Vorstandschef der BASF-Tochter Knoll: „Die Genomanalyse ist noch kein Thema, die weiteren Möglichkeiten zeichnen sich erst ab.“
Nun, da sie auf der Hand liegen, schränkt der Gesetzgeber deren unlautere Verwendung ein. Im April verabschiedete der Bundestag das Gen-Diagnostik-Gesetz. Es verbietet Arbeitgebern, von Angestellten oder Bewerbern einen Gentest zu verlangen oder auf bereits durchgeführte Tests zuzugreifen. Allerdings können sie auf einer solchen Untersuchung bestehen, wenn dies aus Arbeitsschutzaspekten erforderlich ist. Ein Zugriff durch Versicherungen ist auf ähnliche Weise eingeschränkt: Um einem Missbrauch beim Abschluss einer Versicherung zu verhindern, können Versicherungsgesellschaften erst bei einer Versicherungssumme ab 300 000 € den Einblick in einen bereits durchgeführten Gentest verlangen.
Von ihren Angestellten dürfen Arbeitgeber medizinische Untersuchungen einfordern, sofern das in Tarifverträgen, im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung festgelegt ist. Wer sich dagegen wehrt, muss mit einer Abmahnung oder sogar mit einer Kündigung rechnen. Blut- und Gewebeentnahmen hingegen müssen die Beschäftigten nicht dulden. Nur wenn vom Mitarbeiter ein ansonsten unkalkulierbares Sicherheitsrisiko ausgehen könnte, dürfen weitergehende Untersuchungen vorgenommen werden. Zu den betroffenen Berufsgruppen gehören etwa Piloten, Lokführer, Busfahrer, Köche und medizinisches Personal.
Generell darf ein Arbeitgeber auch von Bewerbern eine Blutprobe verlangen. Vornehmen darf er sie aber nur mit deren Zustimmung. Werden dabei Anzeichen für Erkrankungen oder ein Drogenproblem entdeckt, dann ist der Arzt an seine Schweigepflicht gebunden. Er darf dem zukünftigen Chef lediglich mitteilen, ob der Bewerber aus medizinischer Sicht für den Arbeitsplatz geeignet ist oder nicht. Er darf ihm auf keinen Fall sagen, warum nicht.
Am Rande des bei Daimler offengelegten Verfahrens und der juristischen Dimension erhebt sich erneut die Frage der Machtverteilung zwischen Arbeitgeber und Bewerber. Welcher Bewerber kann es sich heute leisten, seine Einwilligung zu einer intensiven medizinischen Untersuchung zu verwehren? Denn ein „Nein“ könnte ihn aus dem Rennen werfen. Die Antwort kann nur jeder für sich geben. CHRISTINE DEMMER
Ein Beitrag von: