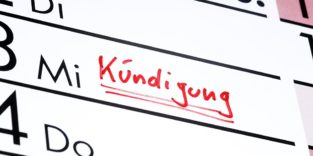Vergütung von Arbeitnehmererfindungen
Tagtäglich machen Ingenieure patentierbare Erfindungen, viele aus einem Angestelltenverhältnis heraus. Die Vergütung dieser Diensterfindungen erfolgt nach einem bestimmten System. In vielen Fällen lässt das Geld aber auf sich warten.

Wem gehören Erfindungen von angestellten Ingenieuren eigentlich?
Foto: panthermedia.net/BrianAJackson
Inhalte dieses Artikels:
- Die drei Anteilsfaktoren
- Lizenzanalogie bestimmt finanziellen Wert
- Warum sich auch Sperrpatente lohnen
- Erfindungen richtig anmelden
- Patentanmeldung – Pflichten des Arbeitgebers
- Vergütungsanspruch bei Arbeitgeberwechsel
- Pauschalvergütung
- Schiedsstelle oder Vergütungsklage
- Arbeitgebervorrecht bei freien Erfindungen
Jährlich werden in Deutschland zehntausende Patente beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet. Allein im vergangenen Jahr waren es 47.779 Anmeldungen, ein Viertel davon konnten dem Technologiefeld Transport zugeschrieben werden. Die Patentanmelder waren folglich meist Firmen, deren Angestellte während der Arbeitszeit Erfindungen gemacht haben. Das DPMA geht davon aus, dass es sich bei rund 94% der Patentanmeldungen um Arbeitnehmererfindungen handelt.
So wie bei Stefan Müller. Er ist Entwicklungsingenieur bei einem mittelständischen Baumaschinenhersteller. Vor zwei Jahren hat er eine Erfindung gemacht, mit der die vertriebenen Baumaschinen einen höheren Wirkungsgrad erzielen können. Der Arbeitgeber hat das Patent zwar angemeldet, aber vorerst liegt es auf Eis. Denn noch ist er Marktführer in diesem Bereich. Und die neue Erfindung passt nicht in seine Unternehmensstrategie. Erst in fünf Jahren, wenn das alte Patent ausläuft, will der Arbeitgeber Müllers Erfindung nutzen, um die lukrative Vorreiterrolle zu behaupten. Nun fragt sich Müller, der in Wirklichkeit ganz anders heißt, wie es denn mit seiner Entlohnung aussieht? „Mir geht es nicht darum, möglichst viel herauszuschlagen. Ich möchte einfach das Gefühl haben, fair behandelt worden zu sein.“
Angestellten Erfindern steht eine Vergütung zu
Die gute Nachricht vorab: Laut Gesetz über Dienst- bzw. Arbeitnehmererfindungen (ArbEG oder auch ArbnErfG) haben Angestellte einen Anspruch auf Vergütung. Eine Orientierung über die Höhe können die das Gesetz ergänzenden „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst“ geben. Den Richtlinien zufolge berechnet sich die Vergütung aus zwei Dingen: Dem Benefit, den der Arbeitgeber aus der Erfindung zieht. Und aus einem Punktesystem, das den Anteilsfaktor des Erfinders am Erfindungswert berücksichtigt. Insgesamt gibt es drei Punktegruppen, die wir im Folgenden erläutern.
Der Anteilsfaktor: Jung-Ingenieur kriegt mehr als der Entwicklungsleiter
Bei der Punktegruppe „Stellung der Aufgabe“ wird die Eigeninitiative des Arbeitnehmers bewertet. „Hier wird unterschieden, ob der Erfinder nur eine Aufgabe lösen musste, die ihm konkret vom Betrieb vorgegeben wurde oder ob er sich aus eigenem Antrieb und außerhalb seines Aufgabenbereichs der Lösung des Problems verschrieben hat“, erklärt Martin Misselhorn, Patentanwalt und Inhaber von MW-Patent in Ingolstadt. Die Punktegruppe „Lösung der Aufgabe“ unterscheide hingegen, ob der Erfinder bei der Lösung auf sich allein gestellt war oder auf betriebliche Mittel und vorhandenes Know-how zurückgreifen konnte. Die dritte Punktegruppe „Aufgabe und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb“ bezieht sich auf die Position und die damit verbundene Erwartung an einen Stelleninhaber. „Hier wird unterschieden, ob es sich beim Erfinder um einen hochbezahlten Entwicklungsleiter handelt, von dem man solche Geistesblitze eigentlich erwartet. Oder um einen Nachwuchsingenieur. Der erhält mehr Punkte“, so Misselhorn.
Je nach Punktzahl wird dem Arbeitnehmer ein prozentualer Anteilsfaktor am finanziellen Nutzen des Arbeitgebers zugesprochen. Bei der Mindestpunktzahl drei liegt der Anteil bei 2%, typische Punktezahlen führen jedoch eher zu einem Anteil von 8 bis 21%.
Lizenzanalogie bestimmt Erfindungswert und Erfinderlohn
Der finanzielle Nutzen wird meist nach der sogenannten Lizenzanalogie berechnet. Er orientiert sich dabei am Erfindungsumsatz. Der wird mit dem üblichen Lizenzsatz multipliziert. „Nehmen wir einmal an, ein Ingenieur hat eine Batterie für Elektroräder entwickelt. Diese wurde bisher 50.000 Mal für einen Stückpreis von 25 Euro verkauft. Dann kann der zu berücksichtigende Umsatz bei 1.250.000 Euro“ liegen, rechnet Misselhorn vor. Allerdings werden oft Umsatzabschläge von 30% und mehr gemacht. Damit wird gegebenenfalls berücksichtigt, dass nicht nur die eine Erfindung maßgeblich für den Umsatz verantwortlich ist, etwa der Akku auch von mehreren Patenten und teuren Zukaufteilen profitiert.
Dabei führt die Bemessung des Umsatzabschlags oft zu Kontroversen, da sie für Unternehmen die effizienteste Stellschraube ist, um die Vergütung zu justieren, erklärt Misselhorn. Dieser Betrag wird mit einer fiktiven Lizenzgebühr multipliziert, die der Arbeitgeber zahlen müsste, wenn er das Patent eines freien Erfinders nutzen würde. Für die Elektroindustrie liegt der Lizenzsatz den Richtlinien zufolge zwischen 0,5 und 5%. „Wenn Sie den Mittelwert von 2,75% ansetzen und wegen der Bedeutung der Erfindung keinen Abschlag machen, entspricht das einer fiktiven Lizenzgebühr von 31.250 Euro. Bei einem prozentualen Anteilsfaktor von 13% ist der Erfinder mit einer Vergütung von 4.062,50 Euro an der fiktiven Lizenzgebühr zu beteiligen, fasst Misselhorn zusammen.
Auch Sperrpatente haben einen finanziellen Wert
Viele Erfinder sind über diese Vergütungshöhe enttäuscht. Zumal der Anteil noch geringer ausfällt, wenn weitere Patente auf dem Produkt liegen. „Die müssen natürlich ebenfalls berücksichtigt werden“, sagt Joachim Mulch, Anwalt und Partner der Kanzlei Graf von Westphalen. Besonders ungünstig sei die Lage für den angestellten Erfinder, wenn der Arbeitgeber das Patent überhaupt nicht nutzt. Denn dann erzielt die Entwicklung auch keinen Gewinn, an dem sich der Erfinderwert bemessen lassen könnte. „Hier stellt sich die Frage, warum er es nicht nutzt“; macht Mulch deutlich. „Wenn er es nicht nutzt um Mitbewerber in Schach zu halten, dann hat es durchaus einen Wert.“ Man spricht hier von Sperrpatenten. In einem solchen Fall wird häufig eine Pauschale gezahlt. Mehr zur Berechnung lesen Sie unten. Zunächst einmal zur Meldung der Erfindung. Denn auch die erfolgt nach einem genauen Prozedere.
Erfindungsmeldung: Die Textform ist Pflicht
Eine Erfindung muss laut § 5 Abs. 1 und 2 ArbEG in Textform gemeldet und beschrieben werden. Der Arbeitgeber muss den Empfang ebenfalls in Textform bestätigen. Der Patentanwalt Johannes Wehner von der Kanzlei Dr. Wehner und Knapp im hessischen Fulda empfiehlt auch Ideen zu melden. „Eine Erfindung muss nicht bis ins Detail ausgereift sein damit sie patentfähig ist. Sie muss neu und gewerblich anwendbar sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit, bzw. auf einem erfinderischen Schritt beruhen.“
Einen Vorschub zur Vergütungsbeurteilung liefert die Meldung der Diensterfindung direkt mit. Denn in §5 Abs. 2 ArbEG heißt es:
„In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht.“
Mehr zum Thema Erfindungen dem Chef richtig melden von Patentanwalt Moritz Höffe.
Patentanmeldung – Pflichten des Arbeitgebers
„Wenn der Arbeitgeber die Form der Einreichung nach zwei Monaten nicht moniert, gilt die Erfindung laut § 5 Abs. 3 ArbEG als ordnungsgemäß gemeldet. Daraus ergeben sich für ihn eine Reihe von Rechten und Pflichten“, erläutert Wehner. So hat der Arbeitgeber eine patentfähige Diensterfindung zur Erteilung eines Patents anzumelden. Es gibt jedoch Ausnahmen: „In einigen Fällen wird das Patent nicht angemeldet, um Betriebsgeheimnisse zu wahren. In diesem Fall hat der Erfinder dennoch einen Vergütungsanspruch, wenn der Arbeitgeber die Erfindung nutzt.“.
Wie der Patentanwalt betont, entsteht durch die Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber ein Vergütungsanspruch dem Grunde nach. „Der Vergütungsanspruch wird – sofern das Schutzrechtserteilungsverfahren noch andauert – grundsätzlich drei Monate nach Aufnahme der Benutzungshandlung fällig, ansonsten gemäß § 12 ArbEG spätestens drei Monate nach Schutzrechtserteilung“. Allerdings sei dies immer für den Einzelfall zu beurteilen.
Vergütungsanspruch besteht bei Arbeitgeberwechsel fort
Viele Unternehmen schieben die Vergütungsfrage jedoch auf die lange Bank. Und Misselhorn erlebt in der Praxis immer wieder, dass Arbeitnehmer aus Angst vor Konflikten mit ihrem Arbeitgeber nicht nachhaken. Die kommen aber spätestens dann, wenn der Arbeitnehmer ausscheidet und keine Rücksicht mehr nehmen muss. „Der Anspruch bleibt – arbeitsvertraglichen Ausschlussfristen zum Trotz – im Regelfall auch nach dem Ausscheiden vorhanden“, so der Diplom-Ingenieur. Eine Ausnahme wäre etwa, wenn der Anspruch nach dem Ablauf der dreijährigen Verjährungsfrist „geblockt“ ist. „D.h. wer einen Anspruch gegen einen anderen zu haben glaubt, muss diesen binnen 3 Jahren ab dem Zeitpunkt geltend machen, ab dem er die anspruchsbegründenden Tatsachen kannte oder kennen musste.“
Pauschalvergütung: Blockbuster-Patente rechtfertigen Nachforderung
Für die Vergütung gibt es unterschiedliche Modelle wie die Berechnung nach Stückzahl. Viele Arbeitgeber nutzen aber stattdessen ein Pauschalvergütungssystem, was aus Arbeitgebersicht auch durchaus empfehlenswert ist. „Bei einer pauschalen Vergütung kann die Vergütung sehr vorsichtig geschätzt daran orientiert werden, wie viele Produkte in einem Zeitraum von etwa 10 bis 12 Jahren verkauft werden“, erläutert Misselhorn. Patente wären zwar 20 Jahre lang gültig, im Mittel seien sie aber nur 10 bis 12 Jahre in Gebrauch. Der Jurist weist allerdings darauf hin, dass der Arbeitgeber bei einem Blockbuster auf Anforderung „noch ein Brikett nachlegen muss“. Nämlich dann, wenn die im Vorfeld gezahlte Pauschalvergütung signifikant zu niedrig geschätzt war.
Auch bei Sperrpatenten kommt häufig eine Pauschalvergütung zum Einsatz. „In diesem Fall ist der Umsatz maßgeblich, den das Unternehmern weniger machen würde“, so Misselhorn. Eine Rechnung, die nur schwer zu kalkulieren ist.
Die Schiedsstelle beim DPMA vermittelt
Gerade bei einer Pauschalvergütung besteht deshalb die Gefahr, dass sich die Seiten nicht einig werden. Für solche Fälle gibt es die Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). „Wenn das Arbeitsverhältnis noch besteht muss sie vor einem Rechtsstreit konsultiert werden. Ansonsten ist die Anrufung freiwillig“, sagt Misselhorn. Die Schiedsstelle blickt neutral auf das Vorhaben und macht unverbindliche Vorschläge. Kommt es nicht zur Einigung, müssen Risiko und Nutzen der dann fälligen Vergütungsklage genau abgewogen werden. „Der Verlierer muss sämtliche Kosten tragen. Je nach Streitwert können diese hoch sein“. Das erfordert eine durchdachte Klagestrategie, um das Risiko möglichst gering zu halten. Auf die Rechtsschutzversicherung sollte man sich hier nicht verlassen, die springt nämlich nicht ein.
Freie Erfindungen von angestellten Ingenieuren
Kommen wir zu den freien Erfindungen. Wenn ein Ingenieur in seiner Freizeit erfinderisch tätig wird, dann muss er das Ergebnis ebenfalls seinem Arbeitgeber in Textform melden. Und gegebenenfalls darlegen, wie er zu dem Geistesblitz kam. In diesem Fall hat der Arbeitgeber drei Monate Zeit, um zu beurteilen, ob es sich dabei tatsächlich um eine freie Erfindung handelt. Selbst wenn das der Fall ist, muss der Erfinder sie dem Arbeitgeber übrigens anbieten. Der hat dann ein nichtausschließliches Recht zur Nutzung zu angemessenen Bedingungen. Nimmt der Arbeitgeber das Angebot innerhalb von drei Monaten nicht an, erlischt das Vorrecht.
Misselhorn rät dazu, eine Erfindung auf jeden Fall zu melden. Selbst wenn sie zunächst nichts mit der Arbeit zu tun zu haben scheint. „Wenn ein Ingenieur für Fahrzeugtechnik einen zusammenklappbaren Sandkasten entwickelt, ist das zunächst unverdächtig. Wenn er aber Kunststoffteile für den Innenraum entwickelt, die speziell geklippt werden und dann im Sandkasten eine ähnliche Verbindung auftaucht, kann das ganz anders aussehen“.
Ein Beitrag von: