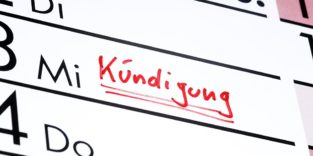Viele profitieren vom Gemeinschaftspatent
Seit Jahren wird in Europa über die Einführung des EU-Gemeinschaftspatents gestritten. Laut BDI steht dabei nicht weniger als die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie auf dem Spiel. Eine Einigung scheiterte bislang vor allem an der Frage, in welche Sprachen die Patentansprüche einer Anmeldung übersetzt werden müssen. Außerdem fürchten die nationale Patentämter schmerzliche Einnahmeeinbußen – zu unrecht, wie eine neue Studie zeigt. VDI nachrichten, Düsseldorf, 5. 3. 10, sta
Wer eine Erfindung europaweit schützen lassen will, muss tief in die Tasche greifen: Ein durchschnittliches Europäisches Patent ist etwa elf mal so teuer wie das entsprechende US-Schutzrecht. Schuld ist die Konstruktion des Europäischen Patents: Es kann zwar einheitlich beim Europäischen Patentamt (EPA) für alle Mitgliedsländer des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) beantragt werden, nach Erteilung zerfällt es aber in ein Bündel nationaler Patente. Es muss also in jedem einzelnen Land, in dem der Schutz gelten soll, durchgesetzt und aufrecht erhalten werden. Anwaltskosten, Übersetzungskosten und Erneuerungsgebühren fallen mehrfach an.
Abhilfe schaffen könnte das EU-Gemeinschaftspatent. Seit Jahren schon wird darüber gestritten. Im Kern sieht es vor, dass die Europäische Gemeinschaft als Ganzes dem EPÜ beitritt. Anmelder müssen dann lediglich die Union als Wirkungsgebiet angeben und ihre Ansprüche in mindestens einer der drei Amtssprachen des EPA (Englisch, Deutsch, Französisch) einreichen. Etwaige Rechtsstreitigkeiten würden vor einem noch einzurichtenden Gemeinschaftspatentgericht verhandelt werden.
Nach einer aktuellen Studie könnten aktive Patentanmelder dadurch jährlich rund 250 Mio. € sparen. Vor allem aber würden viel mehr mittelständische Unternehmen und Universitäten in das Patentierungsgeschehen eingreifen – bislang werden sie von den hohen Kosten vielfach abgeschreckt. Dieser Impuls würde helfen, die Innovationskraft auf dem alten Kontinent rechtlich abzusichern und so die internationale Wettbewerbsfähigkeit beflügeln. Autor der Studie ist Bruno van Pottelsberghe. Er ist Wissenschaftler an der unabhängigen europäischen Denkfabrik Bruegel in Brüssel und Professor an der dortigen Université Libre.
Stellt sich die Frage, warum es das EU-Gemeinschaftspatent noch nicht gibt. Ursächlich sind im Wesentlichen drei Punkte: Zunächst mal leisten verschiedene Lobby-Gruppen heftigen Widerstand. Gemeint sind etwa Übersetzer und (Patent-)Anwälte, die sich auf grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten spezialisiert haben. Daneben sind nationale Befindlichkeiten berührt. So drängt z. B. Spanien darauf, dass Übersetzungen auch in Spanisch vorzulegen seien. Und – last but not least – sträuben sich auch die Patentämter gegen das internationale Schutzrecht. Sowohl das EPA als auch die nationalen Behörden befürchten Macht- und vor allem Einnahmeeinbußen.
Nur das Deutsche Patent- und Markenamt müsste Einbußen verkraften
Dass zumindest die letzte Befürchtung falsch ist, hat van Pottelsberghe in seiner Studie ausgerechnet. Er hat die Zahlungsströme eines in Bezug auf Gültigkeitsdauer und -gebiet „durchschnittlichen“ Europäischen Patents mit denen eines EU-Gemeinschaftspatents verglichen. Dabei unterstellte er, dass das EPA künftig die Hälfte der kassierten Erneuerungsgebühren eines Gemeinschaftspatents an die Nationalen Patentämter (NPA) überweisen würde. Aktuell überweisen die NPA ein Viertel der bei ihnen erhobenen Erneuerungsgebühren der Europäischen Patente an das EPA.
Ergebnis der Pottelsberghe-Simulation: Das EPA könnte sich über Mehreinnahmen in Höhe von 43 Mio. € freuen. Und die NPA würden ebenfalls finanziell profitieren – mit einer Ausnahme: Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Es müsste Einbußen verkraften. Ursache ist, dass die meisten Europäischen Patente auch für Deutschland gültig sind. Das DPMA kassiert also weit mehr Gebühren als etwa das portugiesische Patentamt.
Große Verlierer der neuen Patentierungsmöglichkeit wären die oben genannten Lobby-Gruppen. Sie müssten laut Pottelsberghe auf jährlich rund 400 Mio. € verzichten.
S. ASCHE
Details der Pottelsberghe-Studie können im Internet nachgelesen werden.
www.bruegel.org („Working Papers“)
Ein Beitrag von: