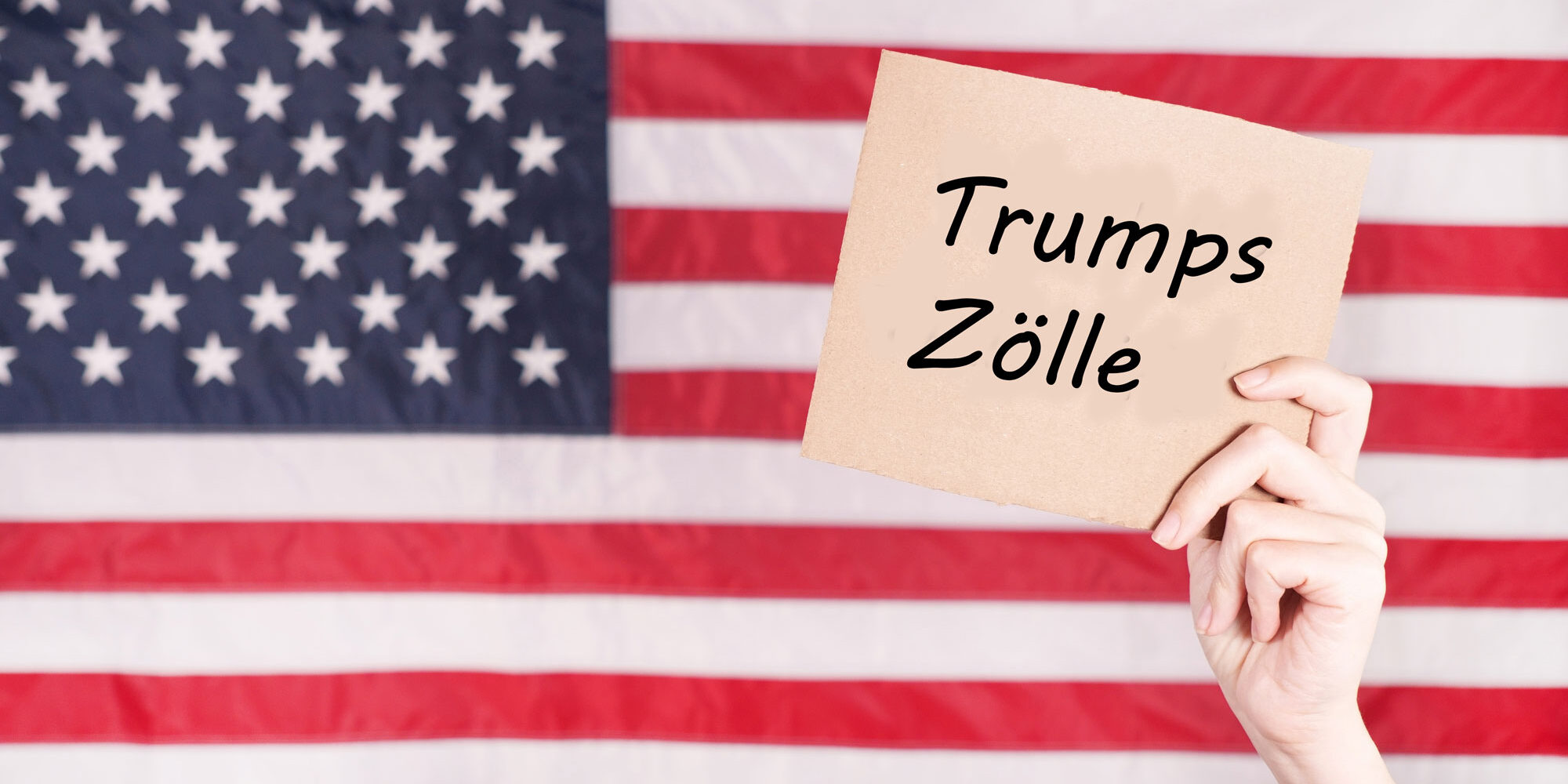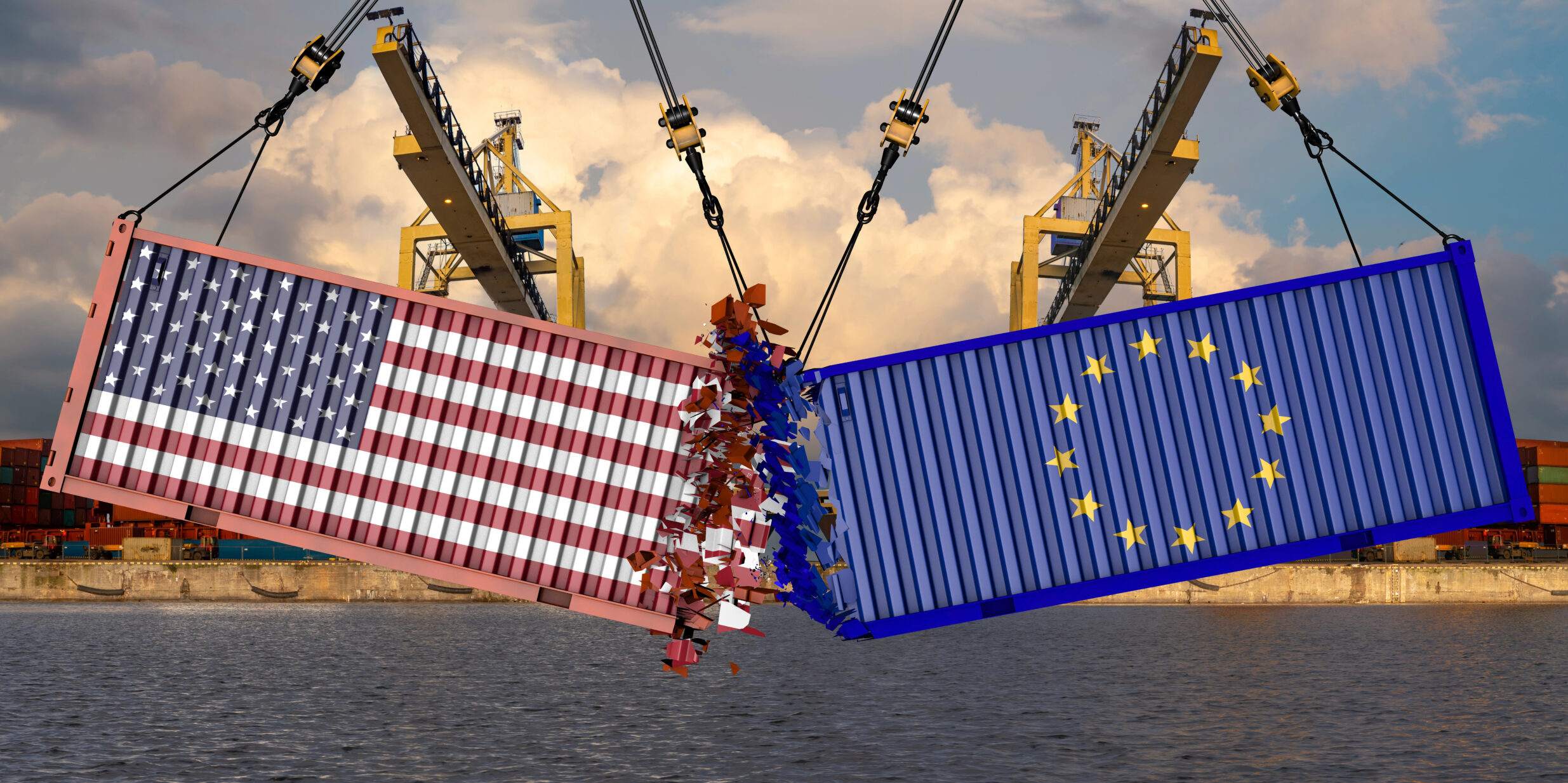Fördergelder eingefroren: Wie sich Havard gegen Trump wehrt
Trump-Regierung friert Milliardenhilfen für Harvard ein. Die Uni will sich nicht bevormunden lassen und wehrt sich öffentlich gegen die Forderungen.

Gebäude von Harvard - die Elite-Uni steckt gerade in einem politischen Machtkampf mit der Trump-Regierung.
Foto: PantherMedia / animagesdesign (YAYMicro)
Die US-Regierung unter Donald Trump hat milliardenschwere Fördergelder für die Elite-Universität Harvard eingefroren. Grund dafür sind politische Differenzen. Harvard weigert sich, die geforderten Auflagen umzusetzen, die unter anderem eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und das Ende von Diversitätsprogrammen vorsehen. Die Regierung wirft der Hochschule mangelnden Einsatz gegen Antisemitismus vor – Harvard weist dies entschieden zurück. Unterstützung bekommt die Universität vom früheren US-Präsidenten Barack Obama.
Inhaltsverzeichnis
Der politische Druck auf US-Universitäten wächst
Die US-Regierung geht derzeit verstärkt gegen Hochschulen vor, deren Werte nicht mit der politischen Agenda von Donald Trump übereinstimmen. Ein aktueller Fall betrifft die renommierte Harvard University. Die Elite-Uni mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, soll Fördermittel in Höhe von über zwei Milliarden Dollar verlieren – weil sie sich weigert, politischen Forderungen aus Washington nachzukommen.
Die Regierung wirft der Universität mangelnden Einsatz gegen Antisemitismus vor. Doch die Forderungen gehen weit über dieses Thema hinaus. Harvard solle ausländische Studierende melden, wenn sie gegen Verhaltensregeln verstoßen. Außerdem soll die Universität die Vielfalt der Meinungen unter Studierenden und Mitarbeitenden überprüfen lassen. Auch Programme zur Förderung benachteiligter Gruppen sollen eingestellt werden.
Politische Einflussnahme auf akademische Freiheit
In einem offiziellen Schreiben der Regierung wurden konkrete Änderungen verlangt. Harvard sollte sich verpflichten, künftig auf Diversitätskriterien bei der Auswahl von Studierenden und Personal zu verzichten. Die Universität solle außerdem mehr Kontrolle über die politische Meinungsäußerung auf dem Campus ausüben.
Die Leitung der Hochschule lehnt diese Forderungen entschieden ab. Alan Garber, Präsident von Harvard, erklärte: „Keine Regierung – unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist – sollte vorschreiben, was private Universitäten lehren dürfen, wen sie zulassen und einstellen dürfen und welchen Studien- und Forschungsbereichen sie nachgehen dürfen.“
Garber betonte, Harvard werde seine Unabhängigkeit nicht aufgeben. Die Rechte, die durch die Verfassung garantiert werden, seien nicht verhandelbar.
Milliarden auf Eis gelegt
Die Konsequenz dieser Verweigerung ist drastisch. US-Präsident Trump hat insgesamt rund 2,2 Milliarden US-Dollar an Fördergeldern eingefroren. Dazu kommen weitere 60 Millionen Dollar aus laufenden Verträgen zwischen der Regierung und der Universität. Die Finanzierung über diese Mittel ist nun gestoppt – zunächst auf unbestimmte Zeit.
Für Harvard ist das ein erheblicher Einschnitt. Die Universität erhält traditionell einen beträchtlichen Teil ihrer Forschungsförderung durch staatliche Programme. Zwar verfügt die Hochschule über eine große Stiftung, doch auch diese hat ihre Grenzen.
Politische Agenda statt Kooperation?
Die Regierung begründet ihr Vorgehen unter anderem mit unzureichendem Engagement gegen Antisemitismus. Doch in der Antwort Harvards wird deutlich, dass dieser Vorwurf nur vorgeschoben scheint. Alan Garber schrieb, das Schreiben der Regierung mache deutlich, dass keine wirkliche Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Antisemitismus gewünscht sei. Stattdessen gehe es darum, politischen Druck auszuüben.
Der Präsident von Harvard kritisierte: „Das Schreiben macht klar, dass nicht die Absicht besteht, mit der Universität zusammenzuarbeiten, um Antisemitismus auf kooperative und konstruktive Weise zu bekämpfen.“
Die Vorwürfe der Regierung stehen auch im Zusammenhang mit Protesten gegen den Krieg in Gaza, die zuletzt an vielen US-Unis stattfanden. Harvard war ebenfalls betroffen. Teile der Regierung sehen in den propalästinensischen Protesten ein Zeichen mangelnder Haltung gegenüber antisemitischen Tendenzen – eine Interpretation, die viele in der Hochschulwelt nicht teilen.
Auch andere Unis unter Druck
Harvard ist nicht die einzige Institution, die in den Fokus geraten ist. Auch die Columbia University in New York hat bereits Zugeständnisse an Washington gemacht. Dabei ging es ebenfalls um Diversity-Programme und die Meinungsfreiheit auf dem Campus. Solche Maßnahmen stoßen jedoch nicht nur auf Zustimmung. Kritiker wie der frühere US-Präsident Barack Obama sehen darin einen gefährlichen Präzedenzfall.
Obama äußerte kürzlich, Universitäten sollten eher ihre Stiftungsgelder nutzen oder Ausgaben reduzieren, anstatt den politischen Forderungen der Regierung nachzugeben. Der Eindruck, Hochschulen würden sich dem Druck beugen, könne langfristig das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Wissenschaft untergraben.
Obama lobt die Uni für die harte Haltung gegenüber Trump
Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Elite-Universität Harvard für ihren Widerstand gegen politische Einflussnahme aus dem Weißen Haus gelobt. Die Hochschule setze damit ein wichtiges Zeichen für andere Bildungseinrichtungen, erklärte Obama, der selbst Absolvent von Harvard ist.
Die Universität habe einen rechtswidrigen und unbeholfenen Versuch zurückgewiesen, die akademische Freiheit einzuschränken. Obama äußerte die Hoffnung, dass weitere Institutionen diesem Beispiel folgen werden. In der Vergangenheit hatte er den Universitäten nahegelegt, lieber ihre Stiftungsgelder zu nutzen oder Ausgaben zu senken, anstatt den Forderungen von Präsident Trump nachzugeben.
Ein Fall mit Signalwirkung
Der Fall Harvard ist ein weiteres Beispiel für die zunehmende Politisierung des Bildungswesens in den USA. Die Trump-Regierung versucht, Einfluss auf Inhalte, Auswahlverfahren und Strukturen der Hochschulen zu nehmen. Besonders Universitäten mit progressiven Programmen zur Förderung von Gleichstellung und Vielfalt stehen im Fokus.
Die Frage, wie viel Einfluss der Staat auf unabhängige Bildungseinrichtungen haben darf, wird dadurch wieder aktuell. Der Streit um Harvard könnte auch langfristig Folgen für andere Hochschulen haben – nicht nur in den USA, sondern weltweit. (mit dpa)
Ein Beitrag von: