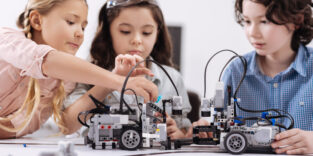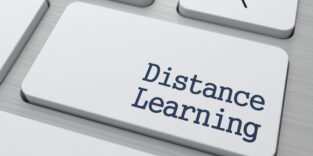Talente stärken – nicht die sozial Starken
Von 100 Akademiker-Kindern in Deutschland nehmen 71 nach der Schule ein Studium auf. In höheren sozialen Schichten seien die Potenziale für den Hochschulzugang ausgeschöpft, schreiben Bernd Kriegesmann und Marcus Kottmann von der FH Gelsenkirchen in folgendem Beitrag. Die Wissenschaftler fordern, „die sich hartnäckig haltende soziale Selektivität von Bildungschancen“ zu überwinden, damit mehr sozial Schwächere ein Ingenieurstudium aufnehmen.
Während die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrisen in Bund, Ländern und Kommunen die Etats aller Ressorts unter Druck setzen, bleibt der Bildungsbereich verschont. Mehr noch, bis 2015 sollen die Ausgaben für Bildung und Forschung auf 10 % des Bruttoinlandsproduktes angehoben werden, was Milliardeninvestitionen erfordert.
Was mit den Investitionen passieren soll, scheint klar. So sollen künftig 40 % aller Schulabgänger eine akademische Ausbildung aufnehmen. Zuwächse erhofft man sich gerade in den für eine innovierende Wirtschaft besonders wichtigen Mint(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)-Fächern. Werden zusätzliche Finanzmittel aber tatsächlich dort investiert, wo die größten Effekte für mehr Ingenieure zu erwarten sind? Schaut man auf bestehende Zuweisungsmechanismen an den Hochschulen, sind Zweifel an diesem Automatismus angebracht.
So hat sich bei höheren sozialen Schichten die Ausschöpfung der Potenziale für Übergänge an die Hochschulen längst dem Grenznutzen angenähert. Von 100 Akademiker-Kindern erreichen in Deutschland 81 die Sekundarstufe II, 71 nehmen nach der Schule ein Studium auf. Sind die Eltern Akademiker und verbeamtet oder selbstständig, studieren weit über 80 % der Kinder. Zusätzliche Investitionen können also nur bescheidene Effekte für „mehr kompetente Mint-Absolventen“ erzielen.
Demgegenüber werden bei Zielgruppen aus sozial schwachen Familien in massiver Form Potenziale verschwendet. Von 100 Kindern aus Nicht-Akademiker-Familien erreichen lediglich 45 die Sekundarstufe II, nur 24 nehmen ein Studium auf. Von 100 Kindern aus Arbeiterfamilien nehmen nur 17 ein Studium auf.
Wenn mehr junge Menschen ein Ingenieurstudium aufnehmen sollen, dann müsste die sich hartnäckig haltende soziale Selektivität von Bildungschancen überwunden werden. Da der Anteil von Jugendlichen aus sozial schwachen Familien in Deutschland eher wieder wachsen wird, können Strategien zur Förderung des Ingenieurnachwuchses, die dieses Thema ausblenden, langfristig kaum zum Erfolg führen.
Es gibt aber nicht nur gravierende soziale Unterschiede bei der Entwicklung von Talenten, sondern auch erhebliche regionale Diskrepanzen. So beträgt der Anteil an Schülern mit Vollabitur in Bottrop 26,2 %, in Gelsenkirchen 28,3 %, in Köln 35 %, in Mülheim schon 39,4 % und in Münster stolze 44,6 % eines Jahrganges.
In bildungsbürgerlich geprägten Regionen wie Münster sehen nicht nur die Wege in die Hochschule anders aus als in strukturschwachen Regionen, sondern auch die Wege im Studium. Die Zusammensetzung der Schülerschaft und das Auftreten sprachlicher oder mathematischer Kompetenzmängel schließen eine vergleichbare Entwicklung der Leistungsniveaus in sozio-ökonomisch unterschiedlichen Regionen fast aus.
Die Spreizung der Eingangsqualifikationen nimmt mit der Vielfalt formaler Zugangswege jenseits des Vollabiturs deutlich zu. Wenn an Hochschulen in Metropolregionen wie dem Ruhrgebiet 30 % Vollabiturienten studieren, in anderen Regionen aber mehr als 50 %, sind andere Beratungs- und Betreuungsangebote im Studium notwendig.
Die Vorstellung, mit an „Normalstudierenden“ ausgerichteten Studienangeboten eine heterogen ausgebildete Jugend zu akademischen Weihen zu führen, geht an der Realität vorbei und führt zu abstrusen Ressourcenzuweisungen im Hochschulbereich. Die Hochschulen mit einer „aufwandsträchtigeren“ Studierendenklientel – aber hohem Potenzial für mehr Ingenieure – schneiden bei der Finanzierung schlecht ab, obwohl sie erhebliche Anstrengungen zur Sicherung des Studienerfolges unternehmen müssen.
So werden über den Hochschulpakt II Bundes- und Landesmittel pro Kopf auf Hochschulen verteilt, unabhängig davon, welche Maßnahmen notwendig sind, um diese völlig unterschiedlichen Köpfe in das System zu bekommen und dann über mehrere Jahre hinweg auf ein international vergleichbares Kompetenzniveau zu entwickeln.
Mehr noch: Mit „leistungsorientierten Mittelverteilungen“ werden in großem Umfang Ressourcen zwischen den Hochschulen auf der Basis von Output-Indikatoren umverteilt.
An Fachhochschulen in NRW führt der mit 85 % gewichtete Leistungsindikator „Anzahl der Absolventen“ seit Jahren zu einer Umverteilung von Ressourcen von Hochschulen mit sozial schwachen Umfeldern hin zu Hochschulen mit besseren sozio-ökonomischen Bedingungen.
Die Zielsetzung der Leistungsorientierung, „Stärken zu stärken“, wird hier durch Systemfehler in ein „Die Starken stärken“ verkehrt. Unter Beibehaltung dieser Verteilungsmechanismen würden zusätzliche Investments auf bildungsbürgerlich geprägte Regionen konzentriert, obwohl dort die zur Steigerung der Anzahl von Mint-Absolventen vergleichbar geringsten Effekte zu erwarten sind. Zudem bliebe die Chance zur Stärkung strukturschwacher Regionen ungenutzt.
Deutschland braucht nicht nur Debatten über mehr Geld für Bildung. Es wäre dringend geboten, über eine qualitative Agenda zu streiten, für wessen Bildung in welchen Regionen investiert werden sollte, um gewünschte Effekte zu realisieren. Gerade die Ingenieurstudiengänge entsprechen dem Bedürfnis von Jugendlichen aus sozial schwachen Familien, über die Ausbildung finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.
Ein solcher Impuls würde nicht nur die Leistungsfähigkeit von jungen Menschen fördern, sondern auch ein nachhaltig verbreitertes Kompetenzreservoir in den Mint-Fächern eröffnen, das die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auch in den nächsten Generationen sichern hilft.
BERND KRIEGESMANN
MARCUS KOTTMANN
Prof. Bernd Kriegesmann ist Präsident der Fachhochschule Gelsenkirchen.
Marcus Kottmann ist Leiter der Abteilung Strategische Projekte der Fachhochschule Gelsenkirchen.
Ein Beitrag von: