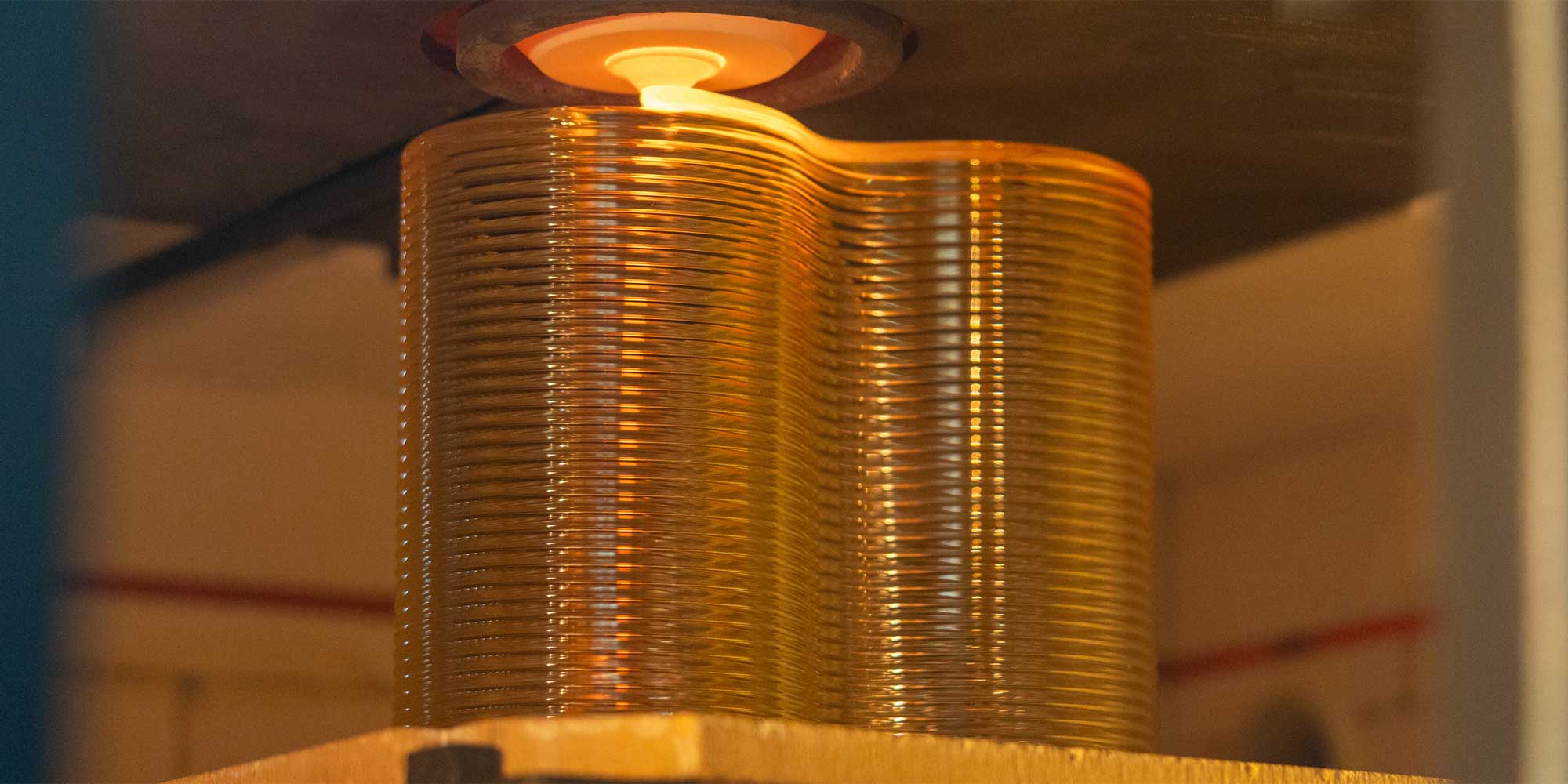Lehmputz: Umweltfreundlich, vielseitig und effizient
Lehmputz erlebt eine Renaissance im Bauwesen. Als natürlicher, atmungsaktiver und umweltfreundlicher Baustoff bietet er zahlreiche Vorteile gegenüber konventionellen Putzen. Seine Eigenschaften machen ihn zu einer Alternative für energieeffiziente und nachhaltige Gebäude.

Lehmputz ist ein traditionsreicher Baustoff, der heute als umweltfreundliche und effiziente Alternative in modernen Gebäuden eingesetzt wird.
Foto: PantherMedia / NataGolubnycha
Lehmputz ist ein traditioneller Baustoff, der in den vergangenen Jahren ein echtes Comeback erlebt hat. Die natürliche Mischung aus Lehm, Sand und verschiedenen organischen Zusätzen wird seit Jahrtausenden zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet. In einer Zeit, in der das Bauwesen immer nachhaltiger und umweltfreundlicher denken muss, gewinnt Lehmputz aufgrund seiner ökologischen Vorzüge und bauphysikalischen Eigenschaften zunehmend an Bedeutung.
Technische Eigenschaften von Lehmputz
Lehmputz besteht hauptsächlich aus Lehm, der mit Sand und verschiedenen organischen Materialien wie Stroh oder Pflanzenfasern gemischt wird. Dieser Mix gibt dem Material seine speziellen physikalischen Eigenschaften. Lehmputz ist porös und atmungsaktiv. Das bedeutet, er kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was ihn zu einem idealen Baustoff für ein gesundes Raumklima macht.
Eines der besonderen Merkmale von Lehmputz ist seine Fähigkeit, Wärme zu speichern und zu regulieren. Aufgrund der hohen Dichte und Wärmekapazität kann Lehmputz die gespeicherte Wärme langsam wieder abgeben. Das trägt zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und kann den Energiebedarf fürs Heizen und Kühlen reduzieren.
Darüber hinaus zeichnet sich Lehmputz durch gute hygroskopische Eigenschaften aus. Er kann Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben. So wird Feuchtigkeit natürlich reguliert, was dabei hilft, die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen im optimalen Bereich zwischen 40 und 60 Prozent zu halten. Das wiederum wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner aus und reduziert das Risiko von Schimmelbildung.
Lehmputz bietet zudem Vorteile beim Schallschutz und Brandschutz. Seine poröse Struktur und hohe Dichte wirken gut gegen Schall, was insbesondere in mehrgeschossigen Gebäuden oder in einer lärmbelasteten Wohngegend Vorteile bringt. Lehmputz ist aufgrund seines hohen Mineralanteils nicht brennbar und kann somit den Brandschutz in Gebäuden verbessern. Vorausgesetzt, das Trägermaterial ist ordnungsgemäß geschützt.
Wie sich Lehmputz anwenden lässt
Lehmputz kann auf verschiedenen Untergründen aufgebracht werden, darunter Mauerwerk, Holz, Stroh und sogar Beton. Er ist für die meisten Innenanwendungen ausreichend tragfähig, wobei die Dicke der Putzschicht und ihre Zusammensetzung je nach Anwendungsbereich variieren können. Wird Lehmputz auf Außenflächen genutzt, sind spezielle Vorkehrungen zum Schutz vor der Witterung erforderlich.
Lehmputz im modernen Bauwesen: Traditionelle und moderne Anwendungen
Lehmputz hat eine jahrtausendealte Tradition und wird heute sowohl beim Restaurieren historischer Gebäude als auch in modernen Neubauten verarbeitet. Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger schätzen Lehmputz, weil er die ursprüngliche Bausubstanz schont und ein authentisches Erscheinungsbild ermöglicht. Im modernen Bauwesen wird Lehmputz zunehmend in Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden und sogar in Bürokomplexen eingesetzt, wo er nicht nur ästhetische, sondern auch funktionale Vorteile bietet.
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von Lehmputz
Als nachhaltiger Baustoff überzeugt Lehmputz durch seine ökologischen und wirtschaftlichen Facetten. Um Lehmputz herzustellen, braucht es im Vergleich zu herkömmlichen Putzen deutlich weniger Energie. Das senkt die CO2-Emissionen. Zudem ist Lehm ein nachwachsender Rohstoff, der regional verfügbar und vollständig recyclebar ist.
In energieeffizienten Gebäuden und Passivhäusern spielt Lehmputz daher eine wichtige Rolle. Seine Fähigkeit, Wärme zu speichern und Feuchtigkeit zu regulieren, unterstützt passive Heiz- und Kühlkonzepte und trägt dazu bei, das Innenraumklima zu stabilisieren. Das kann den Energiebedarf für Heizung, Klimaanlage und Luftentfeuchtung mindern und somit die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes verbessern.
Zudem bietet Lehmputz bauphysikalische Vorteile. Er ist diffusionsoffen und ermöglicht dadurch einen natürlichen Feuchtigkeitsausgleich. In der Folge reduziert sich das Risiko für Feuchteschäden und Schimmel. Seine Fähigkeit, Wärme zu speichern, hält die Temperaturen stabil und kann den sommerlichen Wärmeschutz verbessern. Darüber hinaus kann Lehmputz Schadstoffe und Gerüche aus der Raumluft aufnehmen und so die Luftqualität verbessern.
Lehmputz verarbeiten und anwenden
Wer Lehmputz verarbeitet, sollte einige Details beachten. Das optimale Mischungsverhältnis von Lehm, Sand und organischen Zusätzen hängt von der gewünschten Anwendung ab. Für Grundputze werden oft gröbere Mischungen mit einem höheren Sandanteil verwendet, während Feinputze eine feinere Körnung aufweisen. Die empfohlenen Schichtdicken variieren je nach Anwendungsbereich und liegen typischerweise zwischen 10 und 25 Millimetern (mm) für Grundputze und zwei bis fünf mm für Feinputze.
Lehmputz kann sowohl manuell als auch maschinell verarbeitet werden. Die manuelle Verarbeitung mit Kelle und Reibebrett ist besonders für kleinere Flächen und Ausbesserungsarbeiten geeignet. Bei größeren Projekte bietet es sich an, auf die maschinelle Verarbeitung mit speziellen Putzmaschinen zu setzen, die einen gleichmäßigen Auftrag ermöglichen. Bei beiden Methoden ist es aber wichtig, den Lehmputz in mehreren Schichten zu verarbeiten und dazwischen ausreichende Trocknungszeiten einzuhalten.
Wichtig ist es auch, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten. Dieser muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Stark saugende Untergründe müssen gegebenenfalls mit einer Lehm-Schlämme vorbehandelt werden. Eine der größeren Herausforderungen bei Lehmputz ist die längere Trocknungszeit im Vergleich zu konventionellen Putzen. Das erfordert eine sorgfältige Planung des Bauablaufs und ausreichende Belüftung während der Trocknungsphase.
Bei fachgerechter Anwendung und Pflege kann Lehmputz eine hohe Lebensdauer erreichen. Im Innenbereich sind Lehmputze bei normaler Nutzung sehr langlebig und wartungsarm. Kleinere Beschädigungen lassen sich in der Regel einfach ausbessern, indem neuer Lehm aufgetragen und mit der bestehenden Oberfläche verrieben wird. Für eine lange Haltbarkeit ist es wichtig, den Lehmputz vor direkter Feuchtigkeit zu schützen und in stark beanspruchten Bereichen geeignete Oberflächenbehandlungen vorzunehmen.
Vergleich von Lehmputz mit alternativen Putzarten
Von klassischen Kalk- und Gipsputzen unterscheidet sich der Lehmputz deutlich. Während Kalkputze ähnlich diffusionsoffen sind, können sie dennoch weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Gipsputze sind weniger diffusionsoffen und können Feuchtigkeit daher nur in begrenztem Maße aufnehmen und abgeben. Lehmputz übertrifft beide in Bezug auf diese Fähigkeit sowie bei der Wärmespeicherung. Allerdings ist Lehmputz im Vergleich weniger widerstandsfähig, sowohl gegen mechanische Belastungen als auch gegen direkte Feuchtigkeitseinwirkung.
In der Anschaffung können Lehmputze etwas teurer sein als herkömmliche Putze. Das wird jedoch meist durch die langfristigen Vorteile aufgewogen: die verbesserte Raumluftqualität, das angenehme Wohnklima und die Möglichkeit, durch die klimaregulierende Wirkung des Lehmputzes Energie zu sparen. Zudem sind die Kosten für Wartung und eventuelle Reparaturen bei Lehmputzen oft geringer, da kleinere Schäden einfach ausgebessert werden können.
Hinsichtlich seiner Wirkung auf die Umwelt schneidet der Lehmputz im Vergleich besonders gut ab. Es erfordert deutlich weniger Energie, Lehmputz herzustellen als Zement- oder Kalkputze zu produzieren. Das verursacht entsprechend geringere CO2-Emissionen. Am Ende seiner Nutzungsdauer kann Lehmputz problemlos recycelt oder kompostiert werden. Er hinterlässt keine schädlichen Rückstände. Diese Eigenschaften machen Lehmputz zu einer nachhaltigen Alternative, die den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes positiv beeinflussen kann.
Ein Beitrag von: