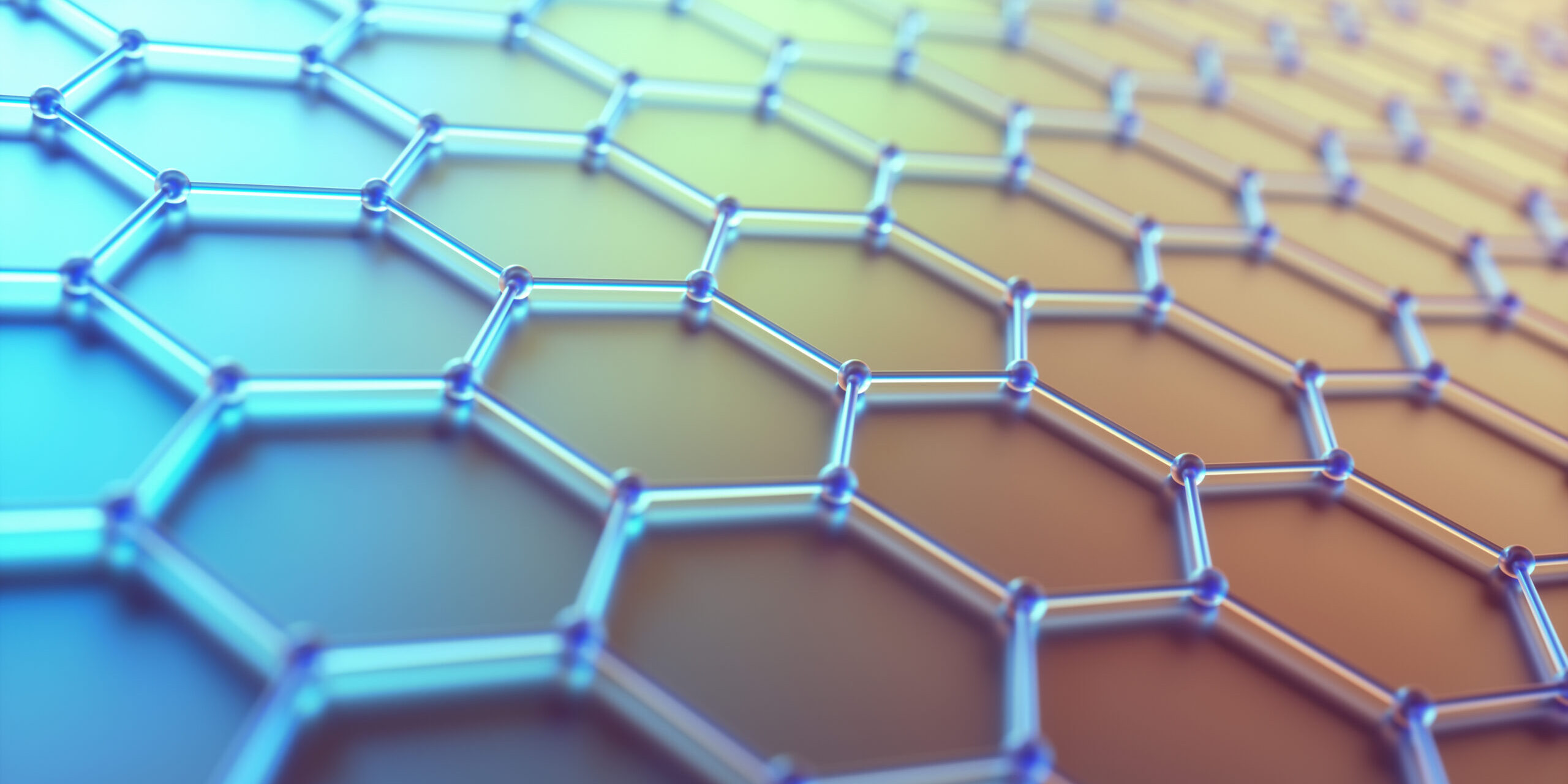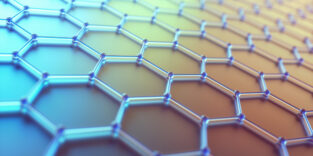Batterie wie Zahnpasta – Forscher entwickeln flexible Energiespeicher
Neue Batterie mit flüssigen Elektroden lässt sich frei formen und eignet sich für tragbare Elektronik und weiche Robotik.

Forschende der Universität Linköping haben eine Batterie entwickelt, die jede Form annehmen kann.
Foto: Thor Balkhed
Forscherinnen und Forscher der Universität Linköping in Schweden haben einen flexiblen Energiespeicher entwickelt, der völlig neue Möglichkeiten für die Gestaltung elektronischer Geräte eröffnet. Die Besonderheit: Die Batterie enthält flüssige Elektroden und kann dadurch jede gewünschte Form annehmen – ähnlich wie Zahnpasta aus der Tube. So lässt sie sich ohne Weiteres in tragbare Technik, weiche Roboter oder smarte Textilien integrieren. Ihre Ergebnisse haben die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht.
„Die Textur ist ein bisschen wie Zahnpasta. Das Material kann beispielsweise in einem 3D-Drucker verwendet werden, um die Batterie nach Belieben zu formen. Dies eröffnet eine neue Art von Technologie“, erklärt Aiman Rahmanudin, Assistenzprofessor an der Universität Linköping.
Inhaltsverzeichnis
Elektronik, die nicht stört
In Zukunft sollen weit mehr Geräte mit dem Internet verbunden sein als heute. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass in zehn Jahren über eine Billion vernetzter Geräte weltweit im Einsatz sind. Neben klassischen Technologien wie Smartphones und Laptops rücken dabei tragbare medizinische Systeme in den Fokus: Insulinpumpen, Herzschrittmacher, Hörhilfen oder Sensoren zur Gesundheitskontrolle.
Diese Geräte müssen möglichst unauffällig, leicht und angenehm zu tragen sein. Feste und sperrige Batterien stören dabei. Die neue flüssige Batterie verspricht hier Abhilfe: Sie ist weich, anpassungsfähig und lässt sich direkt in Kleidung oder Körpernähe integrieren.
„Batterien sind der größte Bestandteil aller Elektronik. Heute sind sie fest und ziemlich sperrig. Mit einer weichen und anpassungsfähigen Batterie gibt es jedoch keine Designbeschränkungen. Sie kann auf völlig andere Weise in die Elektronik integriert und an den Benutzer angepasst werden“, so Rahmanudin weiter.
Der Trick mit den flüssigen Elektroden
Der Kern der Innovation liegt in einem neuen Denkansatz. Bisher versuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, flexible Batterien durch elastische Materialien zu ermöglichen – etwa durch dehnbare Kunststoffe oder Komponenten, die gegeneinander verschoben werden konnten. Das Problem dabei: Je mehr Energie eine Batterie speichern soll, desto mehr aktive Materialien werden benötigt. Das macht sie dicker und gleichzeitig unflexibler.
Das Team um Rahmanudin fand einen anderen Weg: Statt fester Komponenten verwenden sie flüssige Elektroden, also die Teile der Batterie, die den Strom leiten. So lässt sich der Energiespeicher formen, biegen und sogar dehnen – ohne dass seine Kapazität darunter leidet.
„Hier haben wir dieses Problem gelöst und sind die ersten, die zeigen, dass die Kapazität unabhängig von der Steifigkeit ist“, betont Rahmanudin.
Nachhaltige Rohstoffe statt seltener Metalle
Frühere Versuche mit flüssigen Elektroden setzten auf flüssige Metalle wie Gallium. Dieses Material eignet sich jedoch nur für eine der beiden Elektroden (die Anode) und verliert bei Lade- und Entladevorgängen seine flüssige Konsistenz. Zudem sind viele bisher verwendete Materialien umweltbelastend und schwer verfügbar.
Die neue Batterie aus Linköping besteht hingegen aus leitfähigen Kunststoffen, sogenannten konjugierten Polymeren, und Lignin – einem pflanzlichen Reststoff, der in der Papierproduktion anfällt. Damit ist sie nicht nur formbar, sondern auch nachhaltig.
„Da die Materialien in der Batterie konjugierte Polymere und Lignin sind, sind die Rohstoffe reichlich vorhanden. Indem wir ein Nebenprodukt wie Lignin in ein hochwertiges Gut wie ein Batteriematerial umwandeln, tragen wir zu einem stärker kreislauforientierten Modell bei. Es handelt sich also um eine nachhaltige Alternative“, sagt Mohsen Mohammadi, Postdoktorand am Labor für organische Elektronik (LOE).
Technische Werte und Herausforderungen
Die weiche Batterie kann über 500 Ladezyklen überstehen, ohne spürbar an Leistung zu verlieren. Außerdem lässt sie sich auf das Doppelte ihrer Länge dehnen – auch das beeinträchtigt ihre Funktion nicht. Derzeit erreicht die Batterie eine Spannung von 0,9 Volt. Das ist für viele Anwendungen noch zu wenig. Ziel ist es nun, diese Spannung durch gezielte chemische Veränderungen zu erhöhen.
„Die Batterie ist nicht perfekt. Wir haben gezeigt, dass das Konzept funktioniert, aber die Leistung muss verbessert werden. Die Spannung beträgt derzeit 0,9 Volt. Deshalb werden wir nun versuchen, die Spannung durch die Verwendung anderer chemischer Verbindungen zu erhöhen. Eine Möglichkeit, die wir untersuchen, ist die Verwendung von Zink oder Mangan, zwei Metalle, die in der Erdkruste weit verbreitet sind“, sagt Rahmanudin.
Ein Beitrag von: