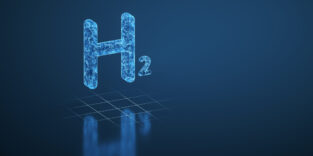Forscher entwickeln Brennstoffzelle fürs Handy
Die Physiker Nicolas Wöhrl und Sebastian Tigges forschen an einem neuen Material, das Brennstoffzellen effizienter machen soll. Wenn die Wissenschaftler aus dem Ruhrgebiet damit Erfolg haben, könnten tragbare elektronische Geräte in Zukunft unabhängig vom Stromnetz werden.

Die Physiker Sebastian Tigges und Nicolas Wöhrl arbeiten daran, Brennstoffzellen sehr viel effizienter zu machen.
Foto: Duisburg ist echt / Duisburg Kontor GmbH
Das ist ja fast wie damals in der Schule. Der Physiker Nicolas Wöhrl (48) stülpt einen Plastikbecher über einen Porzellantiegel. Darauf liegen kleine Kügelchen. Schon bald knallt es – und der Becher fliegt in die Luft. „Das Knallgasexperiment“, sagt der Forscher von der Universität Duisburg-Essen, „das kennen Sie ja sicher noch aus dem Chemie-Unterricht.“
Was war passiert? Wöhrl hat Wasserstoff mit Sauerstoff in Kontakt gebracht. Dazu hatte er zunächst den Becher mit Knallgas gefüllt. Die Kügelchen, die er dann darauf gelegt hat, waren mit Platin beschichtet. Das Edelmetall wirkte als Katalysator und löste eine kontrollierte Reaktion aus zwischen dem Wasserstoff und dem Sauerstoff im Knallgas.
Smartphone mithilfe von Wasserstoff aufladen
Durch die Reaktion entstand Wärme, die die Kügelchen aufgeheizt hat. Als die Temperatur hoch genug war, hat sich das Knallgas entzündet und ist explodiert. „Diesem Prinzip folgt auch die Brennstoffzelle: Aus einer Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff entsteht Energie“, erklärt Wöhrl. Und so langsam dämmert dem Besucher, warum Wöhrl zur Begrüßung das Knallgasexperiment vorführt.
Experte ist sicher: „Wasserstoffauto ist in 10 Jahren Normalität“
Weiter geht’s in ein Labor der Universität Duisburg-Essen. Ein „Vorsicht Hochspannung“-Schild warnt Besucher, hier nichts anzufassen. Schläuche und Kabel hängen von der Decke herab. Überall stehen Apparaturen. In dieser Umgebung arbeitet Sebastian Tigges (30), heute Forscher am Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr, an einem Projekt, bei dem er ein Material entwickelt, um Brennstoffzellen effizienter zu machen.
Wenn Tigges mit seiner Arbeit Erfolg hat, wäre es denkbar, Smartphones an abgelegenen Orten mit Wasserstoff zu laden. Die Brennstoffzelle wäre dann so etwas wie eine unterwegs nachfüllbare Powerbank für das Handy. „Wie cool wäre das, wenn wir irgendwann ein Smartphone in der Hand hielten, das mit auf unserem Material beruht?“, sagt Tigges, während er von seinem Fenster auf den Duisburger Campus blickt.
Nanotechnologie in der Brennstoffzelle
Tigges setzt bei seiner Arbeit auf Nanotechnologie. Sie gilt als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Unter dem Dach des „Center for Nanointegration Duisburg-Essen“ (CENIDE) ist an der Ruhrgebietsuniversität ein Schwerpunkt für diese Forschung entstanden. Winzige Nanopartikel finden sich heute schon in Lebensmitteln, Verpackungen, Textilien, Düngemitteln, Autozubehör, Kosmetika – und eben auch in Brennstoffzellen.
Tesla: Brief an Elon Musk hat Jahre später Folgen
In Duisburg bündelt sich das Know-how von mehr als 70 Arbeitsgruppen. Chemiker, Physiker, Ingenieure, Biologen und Mediziner arbeiten zusammen. Ihr Ziel: „nachhaltige Lösungen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen in den Bereichen Energie, Informationstechnologie und Gesundheit“ zu finden, wie es auf der Webseite des CENIDE heißt.
Teil dieses Forschungsnetzwerks ist auch das moderne Forschungsgebäude „NanoEnergieTechnikZentrum“ (NETZ). Dort befindet sich auch das Labor, in dem Sebastian Tigges und Nicolas Wöhrl ihre Arbeit an dem Nanowerkstoff begonnen haben. Und ihre Arbeit ist ein gutes Beispiel dafür, was sich die Forscher an der Universität Duisburg-Essen so alles ausdenken.
„Wir Physiker denken gerne in Problemen“
Initiiert hat das Projekt, das Tigges nun mehr als drei Jahren beschäftigt, der Physiker Nicolas Wöhrl. „Wir Physiker denken gerne in Problemen“, erklärt der Mann mit den langen Haaren, die er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hat: „Unsere Gesellschaft hat einen großen Energiehunger, den wir nachhaltig etwa mit Solar oder Wind decken können – aber eben auch mit Brennstoffzellen.“
Wöhrl ist nicht nur in Wissenschaftskreisen bekannt. Auch viele Menschen, die nichts mit der Welt der Forschung zu tun haben, kennen den Mann. Seit Mai 2013 betreibt er zusammen mit seinem Kollegen Reinhard Remfort den Podcast „Methodisch inkorrekt!“. Jede Folge wird von mehr als 80.000 Menschen gehört. Hinzu kommen regelmäßige Auftritte bei Fernsehformaten wie „1, 2 oder 3“, „Galileo“, im WDR-Rundfunk oder im Livestream-Kanal von Rocket Beans TV. Und auch bei populärwissenschaftlichen Vorträgen und Science-Slams ist Wöhrl zu sehen.
Endlich eine Lösung für Wasserstoffspeicherung gefunden
Doch zurück ins Labor. Zurück zum Material, an dem Tigges und Wöhrl forschen, um Brennstoffzellen effizienter zu machen. Und zurück zum Knallgasexperiment, bei dem Energie aus Wasserstoff und Sauerstoff entsteht. „Hier ist die Frage, wie wir diese Reaktion sehr effizient machen können“, erklärt Wöhrl. Platin ist selten und kostet viel, außerdem findet die chemische Reaktion nur bei den Atomen an der Oberfläche statt. Hier kommen in Tigges’ und Wöhrls Forschung die winzig kleinen Nanopartikel zum Einsatz. „Viel Oberfläche, wenig Material“, ist der Ansatz, wie der Physiker erklärt. Diese Idee sei auch nicht neu, schon heute finden sich Nanopartikel in Brennstoffzellen. Dabei gibt es aber mehrere Probleme.
Platin-Partikel auf der Brennstoffzelle
Erstens sei es „sehr zeitaufwendig und teuer“ die Nanopartikel herzustellen und anschließend auf ein Grundmaterial wie Kohlenstoff aufzutragen. Dies geschehe in mehreren komplizierten Arbeitsschritten. „Da war unser erster Gedanke, dass wir das in einem Schritt machen wollten“, sagt Sebastian Tigges. „Wir wollten nur auf einen Knopf drücken und hinten fällt am Ende das Material mit den Platin-Partikeln heraus.“
Das zweite Problem: Heutzutage streut die Industrie die Nanopartikel „wie Puderzucker“ über das Kohlenstoff-Gerüst. „Schlecht ist dabei, dass die Nanopartikel so nicht wirklich gut haften“, sagt Wöhrl. Das führt zu einer begrenzten Lebensdauer der Brennstoffzelle. Mit der Zeit gehen Platin-Partikel verloren, die Brennstoffzelle verliert an Effizienz. „Was wäre also, wenn wir die Nanopartikel besser verankern?“, fragten sich die Forscher. Dabei kam den Physikern ihre erste Idee zugute. Da sie das Kohlenstoff-Gerüst nur in einem Produktionsschritt herstellen, ragen die Platin-Partikel etwas aus dem Gerüst heraus und sind verankert im Kohlenstoff.
Das Werkzeug, das die beiden Forscher dafür nutzen, ist ein Plasma-Reaktor. An ihm zeigen sie, wie ihre Idee in der Praxis funktioniert. Sebastian Tigges klettert in seinem weißen Laborkittel einen Tritt hoch, drückt Schalter, dreht Ventile, kontrolliert Anzeigen. „Wollen wir jetzt zünden?“, fragt er. Nicolas Wöhrl nickt und Tigges startet mit einem Knopfdruck den Prozess.
Gasgemisch im Plasma-Reaktor
Es zischt. Ein Argon-Gasgemisch strömt in den mehr als 300 Grad heißen Plasma-Reaktor. In dem Gas ist alles enthalten – unter anderem Kohlenstoff und Platin. „Das ist sozusagen unser Kuchenteig“, sagt Wöhrl, „den wir in den Ofen geben“. Als „Backform“ dient Silizium, auf der nun die Kohlenstoff-Platin-Struktur entsteht. Und wie bei einem Kuchen geht der Teig in der Kammer auf. Langsam entsteht die Nanostruktur. Sie ähnelt einer zerklüfteten Canyon-Landschaft aus schwarzem Gestein.
Wie ihr Material aussieht, wissen die beiden Physiker nur, weil sie es unter dem Rasterelektronenmikroskop untersucht haben. Mit bloßem Auge ist nichts zu sehen. Die Wände der Kohlenstoffstruktur von Wöhrl und Tigges ragen gerade mal fünf bis zehn Nanometer hoch. Ein Nanometer ist ein Milliardstel eines Meters. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist etwa 10.000 mal dicker.

Der Plasma-Reaktor.
Foto: Duisburg ist echt / Duisburg Kontor GmbH
So simpel wie ein Ofen funktioniert der Plasma-Reaktor im Duisburger Labor aber doch nicht. Im Inneren herrschen extreme Bedingungen. Die Temperatur erinnert dabei noch am ehesten an ein herkömmliches Küchengerät. „Wir müssen vor allem die richtige Umgebung schaffen“, betont Tigges den Fokus ihrer Arbeit.
Der vierte Aggregatszustand
Mit 10 Pascal ist der Druck in der Kammer zum Beispiel circa 10.000 mal niedriger als normal. Das Gasgemisch enthält daher 10.000 mal weniger Moleküle als die Atmosphäre, die wir atmen. Magneten erzeugen elektrische Felder, die das Gas ionisieren und in ein Plasma verwandeln. Nicolas Wöhrl spricht in diesem Zusammenhang von einem „vierten Aggregatszustand“. Fest, flüssig, gasförmig und plasmatisch.
Wer durch ein rundes Bullauge in das Innere der kleinen Kammer blickt, erkennt einen weißlichen Schimmer. Das Zusammenspiel der vielen Gase, die ionisiert werden und miteinander reagieren, sorgt für dieses Leuchten.
Heute hat Sebastian Tigges zwar nur einen Knopf gedrückt. Aber bis zu diesem Moment war es ein langer Weg. Rund 125 Versuche waren nötig, um herauszufinden, wie der Prozess optimal abläuft. Jeder Durchlauf dauerte mehrere Tage. Dann mussten die Forscher nachjustieren, um Schritt für Schritt dem Ziel näher zu kommen. „Das nennen wir ganz lieblos Optimierungsarbeit“, sagt Tigges und lacht. „Als Wissenschaftler muss man auch mal Glück haben“, sagt Wöhrl. „Es hat schnell gut funktioniert.“
Teil des größten Projekts für regenerative Wasserstoffproduktion
Ihre Entdeckung haben die Forscher zum Patent angemeldet. Die Arbeit ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass der Ansatz auch in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen könnte. Brennstoffzellen könnten so wesentlich effizienter werden und zum Beispiel eben dazu dienen, portable elektronische Geräte wie Smartphones mit Strom zu versorgen – vom Stromnetz wäre man dann beim Aufladen nicht mehr abhängig. Die Erfahrung, welche Wöhrl und Tigges in Ihrer bisherigen Forschung sammeln konnten, verhalf ihnen nun Teil von H2Giga zu werden. Dem zurzeit größten deutschen Leitprojekt für regenerative Wasserstoffproduktion.
Mehr lesen zum Thema Wasserstoff:
Ein Beitrag von: