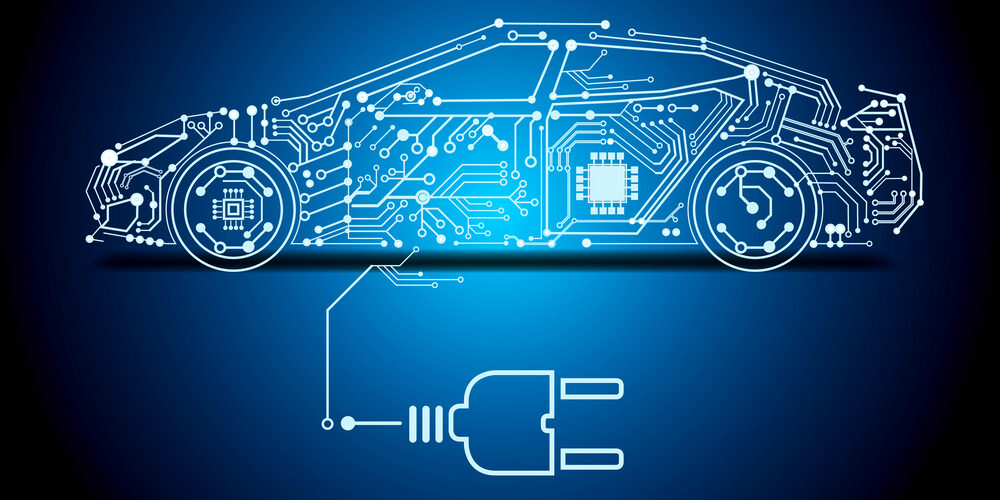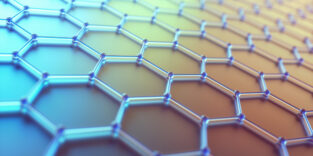So entwickelt sich Europas Batterieindustrie
Die Batteriebranche steht vor einem beispiellosen Wachstumsschub: Expertinnen und Experten prognostizieren eine Verdreifachung der weltweiten Nachfrage bis 2030. Während asiatische Unternehmen den Markt dominieren, kämpfen europäische Produzierende um ihre Position. Doch trotz der schwierigen Ausgangslage bieten sich auch Chancen. Das besagt eine aktuelle Analyse.

Die gegenwärtige Marktsituation stellt europäische Batteriehersteller vor immense Herausforderungen. Besonders die Dominanz chinesischer Firmen, die mit erheblichen Überkapazitäten und aggressiver Preispolitik den globalen Markt beeinflussen, setzt die Konkurrenz stark unter Druck. Dennoch bieten sich für europäische Unternehmen vielversprechende Chancen, vor allem durch ihre Expertise bei Innovationen, hochwertige Produktionstechnologien und nachhaltige Fertigungsprozesse.
Zu diesem Schluss kommt der „Battery Monitor 2024/2025“, für den die Münchner Unternehmensberatung Roland Berger und der Lehrstuhl Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen die Entwicklung von Markt, Technologien und Innovationen der weltweiten Batterie-Industrie analysiert haben. Die vier Autoren Heiner Heimes, Achim Kampker, Wolfgang Bernhart und Isaac Chan betonen, dass der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Massenproduktion sowie intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit entscheidend für den zukünftigen Erfolg sein werden.
Zukunftsszenarien für Batterien bis 2030
Die Marktvolatilität hat 2024 deutlich zugenommen, hebt Wolfgang Bernhart von Roland Berger hervor. Anders gesagt: Die Preise schwanken. Hauptgründe sind die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen sowie regulatorische Unsicherheiten in den USA und der Europäischen Union. Die Fachleute haben daher drei unterschiedliche Zukunftsszenarien entwickelt: Im optimistischsten Fall erreicht die Nachfrage 2030 etwa 4,6 Terawattstunden (TWh), während das Basisszenario von 4,3 TWh ausgeht. Selbst im pessimistischsten Szenario erwarten die Experten und Expertinnen noch ein Bedarf von 4,0 TWh.
Diese Prognosen verdeutlichen das enorme Wachstumspotenzial, zeigen aber auch die Herausforderungen, Produktionskapazitäten präzise zu planen. Die aktuelle Überproduktion in China führt zu einem intensiven globalen Preiskampf, der besonders die europäischen Hersteller belastet, da die Überschüsse größtenteils in den Export gehen. Allerdings produzieren viele chinesische Unternehmen derzeit nicht kostendeckend, was zwar langfristig keine nachhaltige Strategie darstellt, Betriebe in anderen Ländern aktuell aber vor große Probleme stellt. Die europäischen Hersteller investieren sehr zögerlich, da ihnen höhere Produktionskosten und unsichere Absatzprognosen zu schaffen machen. Gleichzeitig dürfte es schwer werden, ohne entschlossene Investitionen wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Gefahr einer Unterversorgung mit europäischen Batterien stufen die vier Experten daher als reales Risiko für die Zukunft ein.
Nachhaltige Batterieproduktion als europäischer Trumpf
Die europäischen Hersteller setzen gezielt auf Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal. Mit dem ambitionierten Ziel, die CO2-Emissionen bei der Batteriezellenproduktion auf 30 bis 40 Kilogramm pro Kilowattstunde zu reduzieren, streben sie eine Vorreiterrolle im globalen Markt an. Vor allem innovative Technologien wie Trockenbeschichtung und Lasertrocknung sollen dabei helfen, den Energieverbrauch deutlich zu senken. Professor Achim Kampker vom RWTH-Lehrstuhl PEM sieht in diesem ökologischen Ansatz einen potenziellen Wettbewerbsvorteil, während europäische Unternehmen bei reinen Kostenstrukturen sonst kaum mit China konkurrieren können. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Rohstoffe. Ziel ist ein kleinerer CO2-Fußabdruck.
Strategische Allianzen für innovative Batterietechnologien
Die Branchenfachleute identifizieren zudem verschiedene strategische Hebel für nachhaltiges Wachstum. Professor Heiner Heimes, Mitglied der PEM-Lehrstuhlleitung, betont die Bedeutung von Innovationen in der Zellchemie: Unternehmen, die frühzeitig auf neue, kostengünstige Batterietypen etwa für kleine und Mittelklasse-Elektroautos setzen, können schneller in die profitable Massenproduktion einsteigen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen europäischen Herstellern sehen die Studienautoren als essenziell an. Allerdings nicht nur: Auch Partnerschaften mit asiatischen Produzenten können sinnvoll sein, um von deren Erfahrung in Forschung und Entwicklung zu profitieren. Denn allein durch mehr Nachhaltigkeit werden die europäischen Unternehmen nicht bestehen können. Günstige Preise sind eine zwingende Voraussetzung für ihre Zukunftsfähigkeit.
Ein Beitrag von: