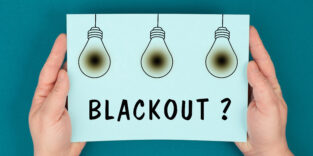Wasserstoffwirtschaft: Hochlauf muss pragmatischer und unbürokratisch laufen
Eine klimaneutrale deutsche Industrie braucht Wasserstoff – doch der Hochlauf stockt. Der VDI erklärt, welche Weichen die Politik jetzt stellen muss.

Wasserstoff: Eine klimaneutrale deutsche Industrie braucht Wasserstoff – doch der Hochlauf stockt. Der VDI erklärt, welche Weichen die Politik jetzt stellen muss.
Foto: PantherMedia / conceptw
Wie der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland gelingen kann, hat der VDI im Rahmen seiner Initiative Deutschland 2050 untersucht. Hintergrund ist, dass trotz der bisher schon klar formulierten Ziele zur Förderung von grünem Wasserstoff sich wenig getan hat. „Wir sind meilenweit von unseren Zielen für die Wasserstoffwirtschaft entfernt“, fasst VDI-Direktor Adrian Willig zusammen. „Es fehlt dabei nicht an technischen Lösungen, sondern es fehlt am passenden Marktumfeld.“
Die Folgen sind, dass die politisch gesetzten Ziele wohl nicht zu erreichen sind. Beispiel: 10 GW Kapazität an Elektrolyseuren sollen in Deutschland bis 2030 stehen, um heimischen grünen Wasserstoff bereitzustellen. „Wir sind froh, wenn wir die 5 GW schaffen“, schätzt Michael Sterner, VDI-Energieexperte und Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat (NWR).
Jetzt hat die kommende Bundesregierung das Thema Wasserstoffwirtschaft noch einmal explizit im Koalitionsvertrag verankert. Daher hat der VDI in einem eigens eingerichteten „VDI Zukunftsdialog Wasserstoff“ unter Leitung von Sterner untersucht, wie es gelingen kann, diese langfristigen Ziele zu erreichen. Pragmatismus statt Überregulierung ist das Gesamtfazit des Gremiums und des vorliegenden Papiers. „Der Hochlauf muss jetzt erst mal in Gang kommen“, sagte Willig, die Devise sei „technologische Vielfalt statt straffen Vorgaben“. Die „Überregulierung bremst“, wenn die Standards zu hoch gesetzt seien, „würgen wir den Hochlauf ab“.
Wasserstoffwirtschaft: Deutschland braucht sie dringend

VDI-Direktor Adrian Willig mahnt, der Hochlauf der deutschen Wasserstoffwirtschaft „muss jetzt erst mal in Gang kommen“. Die Devise dafür sei „technologische Vielfalt statt straffen Vorgaben“. Der VDI fordert mehr Pragmatismus und einen Abbau der Überregulierung.
Foto: Susanne Haberland/VDI
Die Vorgaben für grünen Wasserstoff, der aus dem Ausland kommend in Deutschland auch als „grün“ angekommen ist, sind demnach zu hoch, als dass ein Hochlauf hierzulande funktionieren könne. Dabei sind sich Expertinnen und Experten seit Langem einig, dass Deutschland Wasserstoffimportland sein wird. „So sabotieren wir uns selbst“, glaubt Sterner. Die Folge sei, dass die Erzeuger für grünen Wasserstoff, die es im Ausland gibt, den Wasserstoff gar nicht nach Deutschland lieferten, sondern lieber in andere Abnehmerländer mit liberaleren Vorgaben.
Ganz konkrete Projekte, auch staatliche, bekommen so einfach keine Chance auf Umsetzung. Sterner berichtet von der Bundeswehr, die die Belieferung mit 680.000 l E-Fuels öffentlich ausgeschrieben habe. Sie habe aber kein Angebot bekommen.
„Was derzeit dominant ist, ist das Industrie- und auch das Mobilitätsthema“, sagt Sterner. Beispiel grüner Stahl: Hier sind die Dekarbonisierungspotenziale und die benötigten Wasserstoffmengen riesig, der Umsetzungsdruck mangels Alternativen enorm, und die Investitionen liegen im Bereich vieler Milliarden Euro. Allein: Es stockt. Schneller ginge es vielleicht im Verkehrssektor, auch wenn es batterieelektrisch attraktive Alternativen gibt; der Schritt in die Praxis aber könnte für grünen Wasserstoff hier viel schneller erfolgen. Das aber würde die bisherige gewählte Hierarchie der Anwendungsbereich für Wasserstoff in Deutschland durcheinanderbringen.

Der VDI-Energieexperte Michael Sterner betont, dass Preis- und Abnahmegarantien dem Hochlauf der deutschen Wasserstoffwirtschaft helfen: „Nur wenn Unternehmen verlässlich mit Wasserstoff planen können, investieren sie in die nötige Infrastruktur und Technologien“, so der Professor für „Energiespeicher und Energiesysteme“ an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg.
Foto: picture alliance/dpa/Matthias Balk
Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft braucht koordinierte Maßnahmenpakete
Im Rahmen des „VDI Zukunftsdialog Wasserstoff“ wurde den beteiligten Expertinnen und Experten klar, dass es nicht reichen wird, einzelne Maßnahmen zu benennen. „Das reicht nicht, wir brauchen Pakete“, so Sterner. Eine Art Rosinenpickerei mit wenigen, attraktiven Maßnahmen, das ergibt sich aus dem Papier, reicht einfach nicht aus, um den erforderlichen Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft wirklich anzureizen. Zwar beschreiben die Expertinnen und Experten 28 konkrete Einzelmaßnahmen, sie stellen aber auch zwei Gesamtpakete vor. „Das heißt, es muss gelingen, über 2030 möglichst hinaus einen realistischen, verlässlichen, finanzierbaren Pfad für Industrie und Unternehmen zu beschreiten, damit der Hochlauf von Wasserstoff und die Investitionen gelingen und in größerem Stil als heute ausgelöst werden können“, so VDI-Direktor Willig.
Das erste Paket adressiert, grünen Wasserstoff schneller erzeugen und bereitstellen zu können. Das soll langfristig benötigte (saisonale) Speicherung von erneuerbaren Energien vorbereiten. Hierbei geht es darum,
- das Mengenrisiko für Erzeuger zu verringern,
- das Erlösrisiko zu reduzieren und so die Bildung eines Markts zu unterstützen,
- die Abgabenlast für Wasserstofferzeuger zu reduzieren
- und schlussendlich grünen Wasserstoff gegenüber fossilen Energieträgern konkurrenzfähig zu machen.
Das Maßnahmenpaket 2 legt den Schwerpunkt auf die industrielle Nutzung von Wasserstoff, um so eine langfristige Defossilisierung der Industrie zu ermöglichen.
- Versorgungssicherheit mit Wasserstoff durch Low Carbon Wasserstoff verbessern
- Stärkung der Produktion grünen Wasserstoffs
- Handel von grünem Wasserstoff ermöglichen
- Leuchtturmprojekte und beschleunigte Lerneffekte schaffen
- Grünen Wasserstoff konkurrenzfähig gegenüber fossilen Energieträgern machen
Dezentraler Wasserstoffhochlauf könnte Sinn machen – weil es schneller geht
Die kommende Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag eine verstärkt dezentral und flächendeckend ausgestaltete Elektrolyseurinfrastruktur. In diesem Modell sieht VDI-Energieexperte Michael Sterner angesichts der Schwierigkeiten beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft einen sinnvollen Ansatz. „Das Henne-Ei-Problem kann ich einfacher auf regionaler Ebene lösen“, glaubt der Ingenieur. Zwar bleibt abzuwarten, wie – im Vergleich zur Leistung – die Kosten ausfallen, aber Sterner sieht die Möglichkeit, dass regionale Projekte aufgrund der insgesamt niedrigen Kosten eher eine Chance auf Realisierung haben könnten.
Mehrere kleinere Elektrolyseure könnten auch einfacher stromnetzdienlich installiert werden und daher aus Sicht des gesamten Energiesystems vorteilhaft sein. Ließe sich zusätzlich noch die Abwärme der Elektrolyseure vor Ort in Wärmenetzen nutzen, hätten die Kommunen, die derzeit ihre Wärmekonzepte aufstellen, eine zusätzliche Option.
Ein Beitrag von: