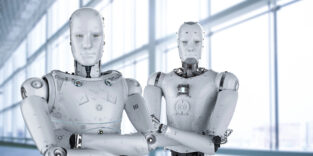40 Jahre CD: Warum der Silberling nicht totzukriegen ist
Vor 40 Jahren begann die Digitalisierung der Musik: mit der ersten CD. Das Streaming läuft den Scheiben zwar längst den Rang ab, aber tot sind sie noch lange nicht.

Ein heute eher seltene Szene: Stöbern in CD-Alben. Doch trotz Streaming ist die Compact Disc immer noch beliebt.
Foto: Panthermedia.net/YuriArcurs (YAYMicro)
Wenn es besonders schlecht für sie läuft, hängen die einst geliebten Silberlinge nun als glitzernder Vogelschreck am Balkongeländer, um verdauungswillige Tauben und Krähen abzuwehren. Und das auch noch an ihrem 40. Geburtstag. Dabei hatte alles so glamourös angefangen, namentlich mit einer Pop-Legende: ABBA ist die Band, die der CD indirekt zum Ruhm verhalf. Am 17. August 1982 wurde im Polygram-Werk Hannover-Langenhagen mit der CD-Version des ABBA-Albums „The Visitors“ die erste Compact Disc kommerziell produziert. Schon bei anderen Tonträgern wie der bis dahin dominierenden Schallplatte war die Fabrik in der Emil-Berliner-Straße, benannt nach dem Erfinder des Grammophons, ein Vorreiter.
Die CD war insofern besonders revolutionär, als sie die Musik endgültig digital machte. Zum einen bedeutete das: Kein Bandsalat im Kassettendeck mehr, kein Rauschen von der Musik-Kassette und erst recht kein Knacken und Springen im Schallplatten-Sound. Vor allem aber legte die CD den Grundstein für das Ende des physischen Mediums selbst. Denn die Umwandlung von Musik in Dateien mit binären Zahlenreihen war die Voraussetzung für alles Folgende: Musik im Internet, Napster, MP3, Spotify.
CD: Klang zu steril?
Die Anfänge der CD-Ära waren geprägt von Debatten darüber, ob der Sound der zwölf Zentimeter großen Silberscheibe zu steril sei im Vergleich zum wärmeren analogen Klang einer Schallplatte. Und von der Kritik am hohen Preis der ersten Abspielgeräte. Doch bei den Verbrauchern kam die CD gut an. Im Jahr 1985 wurden allein in Langenhagen 26 Millionen Scheiben produziert.
Der Musikindustrie bescherte die CD zunächst ein goldenes Zeitalter. Nicht nur damalige Chartstürmer wie Michael Jackson, Madonna oder U2 füllten ihre Kassen. Ob Beatles oder Bee Gees, die Kunden kauften auch millionenfach Musik, die sie schon besaßen, noch einmal auf CD. Manche Alben sogar mehrfach, wenn es Neuausgaben mit aufpoliertem Sound gab. „The Visitors“ von ABBA etwa wurde so noch vier Mal neu herausgebracht.
Wie funktioniert die CD?
Die heute bekannte Audio-CD ist eine Gemeinschaftsentwicklung der Unterhaltungselektronikkonzerne Sony und Philips. Damals konkurrierten verschiedene Ansätze für digitale Aufnahmeverfahren. So gab es für das beliebte Videokassettenformat Betamax analog-digital-Wandler, die eine digitale Musikaufzeichnung ermöglichten. Später sollte mit DAT (Digital Audio-Tape) ein weiteres Format für digitales Audio-Recording auf den Markt kommen. Im Gegensatz zur (optischen) CD waren diesen und anderen Ansätzen jedoch nur kurzzeitige Erfolge gegönnt.
DALL-E mini: KI zeigt schwerwiegendes Problem auf
Mit der Compact Disc, kurz CD setzen Philips und Sony also auf ein optisches Speichermedium: Auf einer durchsichtigen Scheibe aus Polycarbonat liegt eine metallische Schicht, in die – vereinfacht – die digitalen Informationen als kleine „Dellen“ in einer spirlaförmigen Spur – ähnlich wie bei der Schallplatte – eingeprägt werden. Ein Laser kann diese Informationen dann durch eine Schutzlackschicht hindurch abtasten und die Elektronik wandelt sie wieder in Klänge.
Während übrigens eine Schallplatte immer mit der gleichen Umdrehungsgeschwindigkeit rotiert und von außen nach innen abgetastet wird, liest der Laser die CD von innen nach außen und sie verändert dabei ihre Drehzahl.
Beethovens 9. muss drauf!
Legenden ranken sich um die Tatsache, dass das CD-Format mit 12 cm Durchmesser und einer maximalen Laufzeit von 74 min. eingeführt wurde. Es heißt, der damalige Sony-Chef habe darauf bestanden, dass Beethovens 9. Symphonie komplett auf die CD passen sollte.
Herbert von Karajan, ein früher Protagonist digitaler Techniken, hatte eine Einspielung mit 66 min. Laufzeit gemacht, doch die Techniker gingen auf Nummer sicher und nahmen die längste damals verfügbare Einspielung von Wilhelm Furtwängler mit ihren 74 min. als Maßstab. Diese konnten allerdings erst ab 1988 wirklich genutzt werden, da das in den Anfangsjahren verwendete Bandmaterial für den Herstellungsprozess nur 72 min. Musik speichern konnte.
Ein Kopierschutz war auf der CD nicht vorgesehen, da sich damals niemand vorstellen konnte, welche rasante Entwicklung die digitale Musikverbreitung einmal nehmen würde. Die langwierigen Diskussionen um einen Kopierschutz haben dann später die Markteinführung des DAT-Standards so weit verzögert, dass sich das kleine Kassettenmedium nie in großem Stile durchsetzen konnte. Kurios: Als Backup-Medium für PC hatte es dann doch ein längeres Leben.
… und dann kam MP3 und Napster
In Deutschland erreichte der Musikmarkt 1997 einen Höhepunkt mit umgerechnet gut 2,3 Milliarden Euro. Das große Glück der Branche währte jedoch nicht lange. Denn deutsche Forscher entfesselten die umwälzende Kraft der Digitalisierung. Am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen entwickelte ein Team um Professor Karlheinz Brandenburg das Format MP3. Damit ließen sich Musikdateien auf etwa ein Zehntel der CD-Größe reduzieren. MP3 war eigentlich für Radioübertragungen und die Musikindustrie gedacht, doch die Verschlüsselung wurde geknackt. Plötzlich konnte jeder eine CD kopieren und im Internet tauschen. Denn in der Spezifikation der CD war kein Kopierschutz vorgesehen.
Was man Ende der 90er vom MP3-Verfahren hielt, können Sie hier nachlesen: MP3 – Das Musikformat der Zukunft?
Die Musiktauschbörse Napster hatte auf ihrem Höhepunkt mehr als 60 Millionen Nutzer, die Musik einfach downloaden konnte. Ein Gespenst ging um in der Musikindustrie – ein Gespenst in Gestalt einer blauen Katze mit Kopfhörern, die das Markenzeichen des Portals war. Plötzlich waren die bis dahin unantastbaren Werke populärer Bands kostenlos im Netz verfügbar. Die Peer-to-peer-Technologie machte praktisch jedes Lied verfügbar: Das Programm durchsuchte die Festplatten aller Nutzer nach MP3-Dateien, die Ergebnisse waren für alle anderen über einen zentralen Server downloadbar. Ein ganzes Album ließ sich so in für damalige Verhältnisse ultraschnellen drei bis vier Stunden auf die heimische Festplatte saugen. Wer ISDN hatte, war sogar noch schneller als der 56k-Modem-Pöbel.
Die Plattenindustrie überzog Napster mit Klagen und eine Union aus zahlreichen Künstlern, die um ihre Rechte und Einnahmen bangten, schloss sich an. Auch zahlreiche Nutzer wurden abgemahnt. Napster musste schließlich verschwinden, doch andere Webseiten rückten nach und die Umsätze der Musikbranche brachen ein wie noch nie zuvor in der Geschichte der Popmusik.
Beim Neuanfang nach dem Napster-Schock spielte die CD nicht mehr die erste Geige. Mit dem Erfolg des iPod-Players überzeugte Apple-Chef Steve Jobs die Musik-Bosse zum Jahr 2003, dass legale Downloads mit einfacher Bedienung und einem Preis von 99 Cent pro Song die Zukunft sind. Das Streaming, bei dem man die Musik nicht kaufen muss, sondern nur im Abo dafür bezahlt, wirkte schnell wie der nächste logische Schritt – mit dem Durchbruch dauerte es aber, bis schnelle Mobilfunk-Netze und leistungsstarke Smartphones Verbraucher die Sicherheit gaben, dass sie jederzeit an ihre Musik herankommen.
Warum die CD immer noch nicht tot ist
Das Streaming wurde zum neuen Heilsbringer der Musikindustrie. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz der Branche in Deutschland bis auf 1,96 Milliarden Euro. Sie verteilen sich jedoch ganz anders als früher. Gut 68 Prozent davon brachte das Streaming ein, nur noch 3 Prozent dagegen Kauf-Downloads. Die CD kam noch auf respektable 16,3 Prozent. Aus Langenhagen kommt sie allerdings nicht mehr: Das dortige CD-Werk schloss 2017.
Im weltgrößten Musikmarkt USA gab es 2021 sogar eine Gegenbewegung mit einem Absatzplus von 47,7 Prozent. Nun ist es zwar so, dass mit 46,6 Millionen verkauften Compact Discs nur knapp das Niveau vor der Corona-Pandemie mit ihren Laden-Schließungen erreicht wurde. Doch die Erholung zeigt auch: Während Streaming zum Maß aller Dinge in der Musikindustrie wurde, hat das 40 Jahre alte CD-Format noch seine treuen Käufer, die es nicht missen wollen.
Entscheidungen treffen mit KI: Wären Roboter die besseren Richter?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es Sound-Connaisseure, die schwören, der Klang von CD sei schlicht besser als von heruntergeladener Musik. Die Kodierverfahren, die Streaminganbieter nutzern, sorgen in der Tat für Datenverluste. Zudem tendieren Streaming-Dienste dazu, die Lautstärke von Songs zu verändern, damit gemischte Playlists besser durchhörbar sind und nicht allzu leise Lieder auf besonders laute folgen. Das heißt: Die künstlerische Wirkung zahlreicher Musikalben, die bewusst auf viel Dynamik setzen, geht tendenziell verloren.
Und abseits von Technik und Soundqualität: Musikstreaming verführt dazu, Musikwerke nur kurz anzureißen und bei Nichtgefallen sofort beiseite zu schieben. Dass man als Hörer nicht mehr so sehr wie einst in Alben denkt, muss zwar kein Nachteil sein, denn oft lernt man so neue Musik von bis dahin unbekannten Künstlerinnen und Künstlern kennen. Doch das Hören einer CD ist eben auch Genuss: Nur diese zehn Songs zählen dann und wenn der letzte Ton verklungen ist, fängt das selbe Album nochmal vorn an. In der Shuffle-Mentalität des Streamings fällt das eher weg. (mit dpa)
Ein Beitrag von: