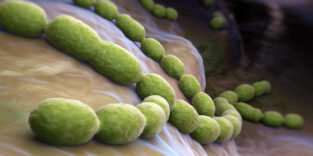Dem grauen Star Einhalt gebieten
Ingenieure der Medizintechnik lernen ihr Fachgebiet aus unterschiedlichen Ingenieur-Blickwinkeln kennen. Als Spezialisten für Medizintechnik mit breiter Ingenieur-Ausbildung können bei ihnen die Fäden der Entwicklung zusammenlaufen. Anke Stübler ist Projektleiterin bei Zeiss und als solche in einer Funktion, von der ihr Chef meint, dass diese ganz typisch für den Beruf wird.

Unsichtbares sichtbar machen ist die Stärke von Zeiss
Foto: Carl Zeiss
Der graue Star ist eine schleichende Krankheit. Zunächst wird der Blick trüb, dann der Nebel immer dichter. Beim einen früher, beim anderen später. Weltweit hat diese Augenkrankheit etwa 20 Mio. Menschen erblinden lassen. Hilfreiche Medikamente gibt es nicht. Allein eine Operation sorgt für wieder klare Sicht. Es ist die am häufigsten durchgeführte Operation weltweit. Auch in Deutschland, hier sind es rund 600 000 Operationen jährlich.
Der Eingriff ist Routine: Mittels Ultraschall zertrümmert der Chirurg die natürliche und setzt an ihrer Stelle eine Kunststofflinse ein. „Wir arbeiten an Lösungen, damit die Operation noch schneller geht, dadurch wirtschaftlicher wird und moderne Operationsverfahren auch in armen Ländern eingesetzt werden können“, sagt Anke Stübler, 29, von Zeiss in Oberkochen. Sie wollte Menschen helfen und zugleich einen technischen Beruf haben. Deshalb ist sie Ingenieurin der Medizintechnik geworden. „Für mich schien das ein idealer Kompromiss.“
Tatsächlich bestand das Studium an der Hochschule Ulm „aus etwas Medizin und ganz viel Technik“. Stübler hat sich wohlgefühlt in den Ingenieurwissenschaften. Mathematik fiel ihr leicht und war ihre Alternative zur Medizintechnik, „aber halt viel zu theoretisch, für eine praktisch veranlagte Frau wie mich“.
Im Herbst 2007 hat die junge Frau ihr Studium abgeschlossen und eine Stelle als Entwicklerin bei einer kleinen Medizintechnik-Firma in der Schweiz angenommen, die Beatmungstechnik entwickelt, beispielsweise Intensivbeatmung für Patienten in Narkose. Fünf Jahre war sie dort und hat in unterschiedlichen Abteilungen gearbeitet. Programmieren hat ihr nicht so gefallen.
Konstruktion sei schon besser gewesen, war aber keine große Herausforderung. Elektronik hingegen schon, da konnte sie zudem simulieren und an Prototypen im Labor testen, ob digitale und reale Welt übereinstimmen. Dann wurde sie Teilprojektleiterin für die Entwicklung eines Anästhesiegeräts, das zugleich beatmen und narkotisieren kann. „In dieser Rolle habe ich mich am wohlsten gefühlt.“
In dieser Zeit übernahm sie für drei Wochen die Urlaubsvertretung für einen Kollegen. Dieser war bei Zeiss in Oberkochen Projektleiter in der Entwicklung eines Augen-Chirurgiegeräts. Stübler scheint ihren Job damals gut gemacht zu haben, denn gegen Ende der Vertretungszeit wurde sie gefragt, ob ich nicht bei Zeiss bleiben will. „Emotional fiel mir die Entscheidung schwer, weil ich mich in der kleinen Firma in der Schweiz wohlgefühlt habe. Aber nach fünf Jahren kann man ruhig eine neue Herausforderung annehmen.“ Seit Januar 2012 ist sie Projektleiterin bei Zeiss Meditec und hat zehn Mitarbeiter im Team. Gemeinsam wollen sie die Operation am grauen Star schneller und effizienter machen.
Die Carl Zeiss Meditec AG ist der Geschäftsbereich Medizintechnik von Zeiss. Das Unternehmen bietet Operationsmikroskope für die Augenheilkunde, Neuro-, Hals-Nasen-Ohren-Chirurgie. Unsichtbares sichtbar machen, darin liegt die Stärke des traditionsreichen Optikkonzerns. Werner Nahm leitet das Entwicklungszentrum der Carl Zeiss Meditec in Oberkochen. Etwa 60 Ingenieure der unterschiedlichsten Fachrichtungen hat er im Team. Und fünf Absolventen der Medizintechnik. „Die Vertiefungsrichtung Medizintechnik gibt es schon lange, etwa in der Elektrotechnik. Medizintechnik als eigenständiges Studium gibt es erst seit einigen Jahren.“ Daher die überraschend geringe Anzahl dieser Spezialisten in einer auf Medizintechnik ausgerichteten Firma.
Beim Einstiegsgehalt gibt es laut Nahm keine großen Unterschiede zwischen Maschinenbauer oder Medizintechnikern. Aber in den Karrieremöglichkeiten: Nahm sieht Medizintechniker häufig in der Rolle von System-Ingenieuren oder Projektleitern, um „die einzelnen Komponenten ihrer Kollegen aus den Fachgebieten Elektronik, Optik, Mechanik oder Informatik zu einem Gesamtsystem zusammenzusetzen“. In einer solchen Rolle befindet sich Anke Stübler. Neben der Technik kommen Managementaufgaben hinzu: „Zwischen Qualität, Zeit und Kosten muss in einem Projekt immer ein Konsens gefunden werden.“ Außerdem beschäftige sie ein hohes Maß an regulatorischem Aufwand: „Jeder einzelne Prozessschritt muss dokumentiert und damit gegenüber Behörden, beispielsweise medizinischen Zulassungsstellen, nachweisbar sein.“ Nach fast einem Jahr hat sich Stübler gut eingearbeitet. „Ich bin angekommen und angenommen.“
Akzeptanzprobleme, weil sie jung und eine Frau ist, und damit auf Vorurteile treffen könnte, hat sie nicht. Sie hat ein Ingenieurstudium wie die meisten ihrer Kollegen auch. In dem hat sie gelernt, komplexe technische Zusammenhänge zu verstehen, zu analysieren und Probleme einfach zu lösen. Das sei keine Frage des Geschlechts, sondern allein der Technik.
In ihrer Funktion als Projektleiterin hat sie es nicht nur mit Kollegen aus ihrer Abteilung zu tun, sondern mit dem Einkauf, der Qualitätssicherung und Zulassungsstellen in unterschiedlichen Ländern. Diese interdisziplinäre Arbeit gefällt ihr, weniger Spaß macht es Stübler, wenn Interessen weit auseinander liegen. „Kompromisse sind halt immer auch ein Stück Zugeständnisse.“
In einer kleinen Firma anzufangen und dort alle Ingenieuraufgaben kennenzulernen, hält sie für einen guten Berufseinstieg für Ingenieure der Medizintechnik. Dann in eine große Firma als Projektleiterin zu wechseln, sei karrierefördernd. Was sie sich zurzeit wünscht, ist ein eigener Parkplatz, damit sie morgens nicht so früh raus muss. Mit allem anderen ist sie rundum zufrieden. PETER ILG
Ein Beitrag von: