Neue Medikamente – kreiert von einer KI
Zahlreiche Datensätze waren notwendig, um den Algorithmus zu trainieren. Dabei herausgekommen ist eine KI, die pharmazeutische Wirkstoffe erstellt. Basis dafür sind dreidimensionale Oberflächen eines Proteins. Der Vorteil: Wechselwirkungen werden bereits im Vorfeld erkannt und ausgeschlossen.
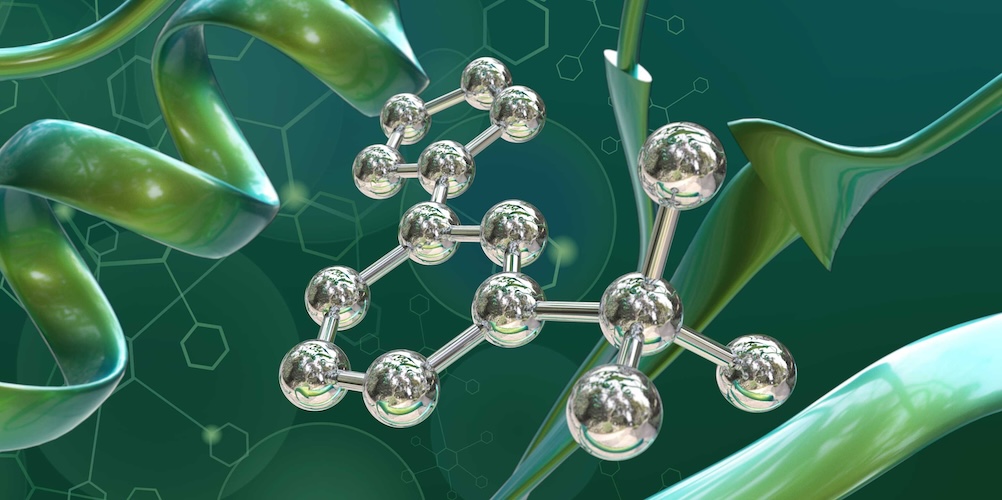
Die Grafik zeigt die von einer generativen KI entwickelten Moleküle. Diese passen von Anfang an genau zu einem Protein passen, mit dem sie reagieren sollen.
Foto: ETH Zürich / Gisbert Schneider
Die Vorarbeit leistet die künstliche Intelligenz (KI), die Feinarbeit übernehmen anschließend Chemikerinnen und Chemiker im Labor. Das Ergebnis: neue Medikamente auf Basis von Proteinstrukturen. Die Forschenden der ETH Zürich, denen aktuell dieser Durchbruch gelang, sind sich sicher, mit dieser Entwicklung die Medikamentenforschung zu revolutionieren. Den dazu notwendigen Algorithmus haben Gisbert Schneider, Professor am Departement Chemie und angewandte Biowissenschaften an der ETH Zürich, und sein ehemaliger Doktorand Kenneth Atz. Der Algorithmus ermöglicht es, mithilfe von KI neue pharmazeutische Wirkstoffe zu kreieren.
Microsoft zeigt neue KI-Assistenten für die Industrie
Das funktioniert, indem zu jedem Protein die notwendigen Baupläne für Moleküle produziert werden können. Voraussetzung dafür ist, dass die dreidimensionale Form des jeweiligen Proteins bekannt ist. Für den Algorithmus ist nur die entsprechende Oberflächenstruktur relevant. Die erzeugten Moleküle können sich nach dem sogenannten Schlüssel-Schloss-Prinzip dann an das jeweilige Protein binden und die jeweiligen erwünschten Wechselwirkungen erzeugen. Bei den Molekülen handelt es sich also dann um mögliche Medikamente, welche die Aktivität des Proteins erhöhen oder hemmen. Und im Anschluss bearbeiten Chemikerinnen und Chemiker die Moleküle, inklusive notwendiger Tests.
Medikamente dank KI: Nebenwirkungen im Vorfeld schon ausmerzen
Dieses neue Verfahren ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschungen. Im Zentrum dieser stand die Suche nach der konkreten dreidimensionalen Struktur von Proteinen inklusive der Suche nach dazu passenden potenziellen Wirkstoffmolekülen. Solche Forschungsprojekte sind insgesamt sehr zeitaufwendig und beinhalten zudem auch eine Menge Handarbeit. Denn die Chemikerinnen und Chemiker stießen in all den Jahren vor allem auf schwer oder gar nicht synthetisierbare Moleküle. KI kam im Rahmen des Projekts mehrfach zum Einsatz. Doch der Druchbruch gelang durch eine generative KI, die ohne menschlichen Eingriff Wirkstoffmoleküle kreiert, die zu einer Proteinstruktur passen.
Der Vorteil an diesem Verfahren auf Basis generativer KI: Es werden nur Moleküle entwickelt, die chemisch synthetisierbar sind. Darüber hinaus liefert die KI nur Vorschläge für Moleküle, die mit dem entsprechenden Protein an der gewünschten Stelle auch reagieren – dafür aber eben nicht mit anderen Proteinen. „Das heißt, wir können schon beim Entwurf eines Wirkstoffmoleküls berücksichtigen, dass es möglichst wenig Nebenwirkungen hat“, sagt Atz. Für das notwendige Training der KI setzen die Forschenden auf Datensätze sehr vieler bekannter Wechselwirkungen zwischen chemischen Molekülen und den dazugehörigen dreidimensionalen Proteinstrukturen.
KI entworfene Medikamente zeigen sich sehr stabil
Die ersten Tests machten die Forschenden der ETH Zürich mit Proteinen aus der Gruppe der PPAR. Sie sind im Körper für die Regulierung des Zucker- und Fettsäure-Stoffwechsels zuständig. Die derzeit bekannten Diabetes-Medikamente interagieren mit diesen Proteinen, indem sie deren Aktivität steigern. Dadurch können die Zellen mehr Zucker aus dem Blut aufnehmen, was zugleich für einen sinkenden Zuckerspiegel sorgt. Die von der KI generierten Moleküle hatten einen ähnlichen Einfluss wie die Medikamente. Nach einer Reihe von Tests im Labor ergab sich, dass die neuen Moleküle auch wie gewünscht stabil und nicht giftig sind.
„Mit unserer Arbeit haben wir die Welt der Proteine für die generative KI in der Wirkstoffforschung zugänglich gemacht“, sagt Gisbert Schneider. „Der neue Algorithmus hat ein enormes Potenzial.“ Schneider hält ihn für wichtig, weil er praktisch auf alle medizinisch relevanten Proteine des menschlichen Körpers anwendbar ist. Vor allem aber für die, deren chemischen Verbindung die Forschenden noch nicht kennen, die mit diesen in Wechselwirkung treten. Die Ergebnisse waren für die Forscherinnen und Forscher so vielversprechend, dass sie das Verfahren auch anderen Fachbereichen zur Verfügung gestellt haben. Das hat zur Folge, dass es bereits auch in anderen Studien zum Einsatz kommt. Unter anderem im Rahmen eines Projekts im Kinderspital Zürich, bei dem es um die Behandlung von Medullblastomen geht. Das sind bösartige Hirntumore, die gerade bei Kindern ganz besonders häufig auftreten. Die Chemikerinnen und Chemiker der ETH Zürich haben sowohl den Algorithmus, also auch die dazugehörige Software inzwischen veröffentlicht.
Ein Beitrag von:




















