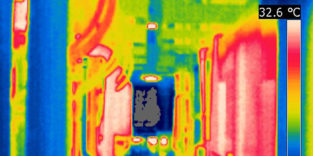Patienten unterm Strichcode
Im Krankenhaus der Zukunft wird alles besser, sicherer, effizienter – das versprechen Fraunhofer-Forscher des Hospital Engineering Labors. Sie testen im Duisburger inHaus-Zentrum, ob und wie elektronische Assistenzsysteme Patienten und Personal das Leben erleichtern.

Die Betten im Patientenzimmer sind mit Display und Sensorik ausgerüstet, die erkennen, ob Patienten liegen, sitzen oder das Bett verlassen haben.
Foto: Fraunhofer ISST
Die Wände sind in Creme und Lindgrün gehalten, die Bettwäsche blütenweiß und die Möbel tragen freundliches Birkendekor. Das Licht wurde gedimmt, die Luft ist angenehm kühl und das großzügige Fenster lenkt den Blick ins Grüne. Zwei Schritte weiter präsentiert sich ein Bad mit erstaunlich viel Platz, Armaturen vom Feinsten und einer großen, barrierefreien Dusche. Hier könnte man sich fast wohl fühlen.
Aber nur fast – denn das Zimmer ist ein Patientenzimmer im Krankenhaus. Allerdings wird hier nie ein Kranker auf seine OP warten und keine Schwester Pillen verteilen. Denn Zimmer und Bad sind Teil des Hospital Engineering Labors, in dem Fraunhofer-Forscher und Firmen bis 2014 mit finanzieller Unterstützung von EU und dem Land NRW das „Krankenhaus der Zukunft“ entwickeln.
40 Prozent der Arbeitszeit werden in Dokumentation und Abrechnung investiert
Jede fünfte Klinik in Deutschland steckt in den roten Zahlen. Das ist kein Wunder: Die Behandlungstechnik wird immer kostspieliger, die Logistik komplexer und die Verwaltung ist mittlerweile so aufwendig, dass Ärzte und Pfleger 40 % ihrer Arbeitszeit für Dokumentation und Abrechnung benötigen. Gleichzeitig liegen in den Hospitälern immer mehr Demenzkranke und Multimorbide, weit mehr alte und pflegebedürftige Menschen als früher.
Es ist also wie die Quadratur des Kreises: Die Patienten benötigen umfassende Behandlung und Pflege, aber auch Überwachung und Zuwendung. Zugleich ist das Personal knapp und die Pflegezeit strikt begrenzt, weil das Krankenhaus als öffentliches oder privates Unternehmen ökonomisch wirtschaften muss.

Der mit viel Elektronik ausgestattete Pflegewagen im Hospital Engineering Labor registriert, welche Materialien verbraucht werden. Er soll später mit medizinischen Geräten bestückt werden, die die Daten des Patienten dann sofort weiterleiten.
Quelle: Fraunhofer ISST
Wie aber wird ein Krankenhaus kosteneffizienter und besser zugleich? „Durch intelligente Technik“, ist Wolfgang Deiters überzeugt. Damit könnten sowohl Versorgungsqualität als auch Kosteneffizienz im gesamten System erhöht werden, sagt der Projektleiter am Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST.
Forschungs- und Kooperationsplattform
Wie das aussehen kann – das soll die Mitte Juli offiziell eröffnete Forschungs- und Kooperationsplattform im Fraunhofer inHaus-Zentrum in Duisburg zeigen. Auf rund 350 m2 wurden neben dem Patientenzimmer auch Stationszimmer, Untersuchungsraum, Teeküche, Materiallager, OP und Reha-Bereich installiert und beispielhaft mit neuester Technik ausgestattet. Hier können die Forscher gemeinsam mit rund 40 Firmen und acht Kliniken der Region zahlreiche Innovationen auf ihre Auswirkungen, die Amortisation und Praktikabilität prüfen.
Zurück im Patientenzimmer. Erst beim genauen Hinsehen fällt der Blick auf Dinge, die man aus einem normalen Krankenhaus nicht kennt: Im Bettgestell sind seitlich mehrere Sensoren integriert, am Fußende ist ein kleines Display mit Touchscreen montiert und der Türrahmen trägt Bewegungsmelder.
Viel Elektronik im Bad
Im Bad wartet gleich neben dem Eingang ein kleines Lesegerät auf Dateneingabe, unter WC und Waschtisch sitzen Motoren zum Höhenverstellen, aus der barrierefreien Duschwanne führen mehrere Kabel zum externen Steuergerät. „Ein Patient wäre hier stets unter Beobachtung, was seine Sicherheit und Versorgung deutlich verbessert“, betont Levent Gözüyasli, der sich am Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme IMS insbesondere mit sogenannten elektronischen Assistenten beschäftigt.
Elektronische Assistenzsysteme spielen im Krankenhaus der Zukunft eine große Rolle. Sie sollen vor allem die Sicherheit verbessern und die Überwachung von Patienten erleichtern. Umgebungs- oder Körpersensoren melden beispielsweise per Funk, ob und wann der Kranke das Bett oder das Zimmer verlässt.
Ein selbstklebendes Papierband mit Namen und Strichcode am Arm identifiziert jeden Patienten während des gesamten Aufenthalts und ist zugleich Steuerinstrument: Führt der Kranke den Barcode des Armbands im Bad über den kleinen Scanner an der Wand, werden automatisch WC und Waschtisch auf eine der Körpergröße angepasste Höhe gefahren.
Selbst auf einen Sturz in der Dusche ist die Elektronik vorbereitet: Unter der Duschwanne sitzt ein Netz aus kapazitiven Sensoren, die einen stehenden Menschen von einem gestürzten unterscheiden können, weil ein liegender Körper das elektromagnetische Feld der Sensoren weitaus stärker beeinflusst.
Auch selbstlernende Systeme werden fürs Krankenhaus angepasst
Es geht aber nicht nur um Patientensicherheit – elektronische Assistenzsysteme sollen auch Pflege vereinfachen, Doppelarbeit verhindern, Dokumentation, Einkauf und Logistik automatisieren und die gesamte Datenverwaltung transparenter machen. Die Forscher beginnen dabei nicht bei null, denn im Alltag sind Assistenzsysteme schon weit verbreitet – beispielsweise als persönlicher Assistent im Smartphone oder als Roboter in der Industrie. „Auch selbstlernende Systeme sind bereits im Einsatz und können fürs Krankenhaus angepasst werden“, sagt Gözüyasli.
Diese Anpassung ist allerdings nicht simpel: Innovationen im Krankenhaus sind nur bei kurzen Zeiten für Return-of-Investment und nur bei reibungsloser Verankerung in den Abläufen sinnvoll und akzeptiert. Genau deshalb zögern Kliniken meist mit der Einführung von neuen Produkten und Leistungen. Ein Krankenhaus ist zudem ein Kosmos voller Menschen. Menschen, die Fehler machen, mal mehr, mal weniger motiviert sind, den Umgang mit Technik nicht immer gewohnt sind.
„Daher testen wir naive Sensorik, die nur zwischen Ja und Nein unterscheiden kann, aber auch sehr komplexe Systeme“, so Gözüyasli. Sensoren fungieren dabei wie Sinnesorgane der elektronischen Assistenten, sie überwachen das direkte Umfeld oder auch die Vitalfunktionen direkt.
Um praktikabel zu sein, müssen Sensoren aber nicht nur den einzelnen Parameter, sondern auch den Kontext erfassen. Sie müssen mit anderen Fühlern sowohl auf Datenebene als auch inhaltlich gekoppelt werden, außerdem ortsunabhängig und flexibel sein. Nur so entstehen Assistenten, die automatisch und in Echtzeit Daten über Krankheit und Pflege, Art der Behandlung, Lagerbestände oder Medikamentenverbrauch liefern und dokumentieren und damit das ganze System Krankenhaus flexibler und sicherer machen.
Anspruchvolles Zusammenspiel
Ist heutige Sensorik für das Krankenhaus der Zukunft bereits praktikabel und kann sie den Pflegealltag vereinfachen? Das testen Experten des IMS am Beispiel eines Pflegewagens, der gemeinsam mit der Imbusch Systemmöbel GmbH und der Ophardt Hygiene-Technik entwickelt wurde. Dank berührungslosem Desinfektionsmittelspender, Schubladen mit Entnahmeerkennung und Dockingstation fürs Tablet erfasst der Wagen, welche Schublade geöffnet und wie viel Verbandsmaterial oder Medikamente entnommen wurden und meldet die Daten per WLAN an die jeweilige Station.
Schon an diesem einfachen Beispiel merken die Entwickler, wie anspruchsvoll das Zusammenspiel von Mensch und Maschine im Krankenhaus ist. Noch erkennen die Sensoren nicht, welcher Patient gerade behandelt wird und welche Pflegerin Dienst hat. Sie registrieren zwar, wie viel Desinfektionsmittel verbraucht wird, warnen die Krankenschwester aber nicht, wenn sie das Desinfizieren der Hände mal vergessen hat. Im Endausbau soll der Wagen auch medizinische Geräte an Bord haben, automatisch an den Einkauf melden, wenn beispielsweise Handschuhe oder Verbandszeug zur Neige gehen, und direkt mit der Pflegerin kommunizieren können. Bis dahin ist es allerdings noch ein ganzes Stück Weg.
Gewonnene Zeit für Pflege nutzen
Manche Verbesserungen im Krankenhaus sind aber auch ganz simpel. Versuche im inHaus haben gezeigt, dass Pflegebedürftige sich wohler fühlen und ruhiger schlafen, wenn die Lampen im Zimmer die natürlichen Lichtverhältnisse und Spektren imitieren. Für alte Menschen und Demenzkranke ist es schon eine große Hilfe, wenn sie statt komplizierter Multimediageräte einfache Telefone mit nur wenigen Tasten vorfinden.
Und für jede Klinik in Deutschland gilt: Dass Technik Zeit einsparen hilft, ist eine schöne Sache. Im Sinne des Patienten ist dies aber nur dann, wenn Ärzte und Personal die gewonnene Zeit dafür nutzen, wofür sie eigentlich da sind: um ihre Kranken zu pflegen und zu versorgen.
Ein Beitrag von: