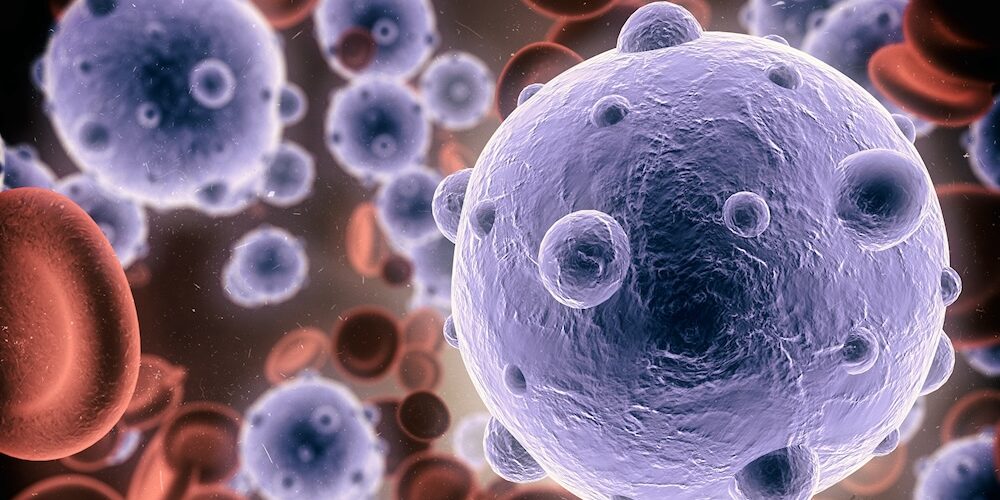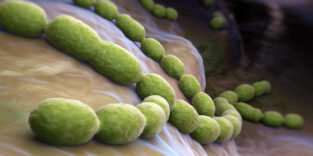Personalisierte Medizin: Sind Biosensoren aus dem Drucker die Zukunft?
Forschende haben eine neue Technik entwickelt, die es ermöglicht, spezielle Nanopartikel zum Drucken zu verwenden. Auf diese Art und Weise ließen sich Biosensoren als Massenprodukt herstellen, die eine Vielzahl von Biomarkern wie Vitamine, Hormone und Medikamente in Echtzeit überwachen können.

Der Biosensor befindet sich in einer Art Pflaster. Auf diese Art und Weise haben die Forschenden ihn bei Long-COVID-Patienten eingesetzt.
Foto: Caltech
In der Medizin dreht sich vieles darum, die Gesundheitsversorgung immer weiter zu personalisieren. Damit jeder Mensch die passenden Medikamente und Nährstoffe erhält, braucht es ein individuelles Grundlagenwissen. Dazu zählen spezifische Biomarker, die kontinuierlich gemessen und überwacht werden sollten. Genau hier setzt die Forschung eines Teams von Ingenieuren des California Institute of Technology (Caltech) an. Das Team hat eine Methode entwickelt, mit der spezielle Nanopartikel zum Drucken von Sensor-Arrays verwendet werden. Mit dieser Technik soll es möglich werden, langlebige, tragbare Schweißsensoren in Masse zu produzieren. Die Sensoren können zur Echtzeitüberwachung diverser Biomarker wie Vitamine, Hormone, Stoffwechselprodukte und Medikamente eingesetzt werden. Sie bieten eine lückenlose Verfolgung der Molekülspiegel.
3D-Druck mit Blut: Schneller heilen mit körpereigenen Ressourcen
Die Wirksamkeit der neuartigen Biosensoren wurde bereits in der Praxis unter Beweis gestellt: Am City of Hope in Duarte, Kalifornien, kamen sie erfolgreich zur Überwachung von Stoffwechselprodukten bei Long-COVID-Patienten sowie zur Kontrolle der Chemotherapeutika-Konzentration bei Krebspatienten zum Einsatz. „Dies sind nur zwei Beispiele für das enorme Potenzial“, betont Wei Gao, Professor für Medizintechnik am Caltech. „Wir können nun eine Vielzahl chronischer Erkrankungen und ihrer Biomarker kontinuierlich und nicht-invasiv überwachen.“
Biosensoren bestehen aus kubischen Nanopartikeln mit Kern-Schale-Struktur
Die Forschenden beschreiben die Nanopartikel als kubische Partikel mit Kern-Schale-Struktur. Ihre Herstellung erfolgt in einer Lösung, die gleichzeitig auch das Molekül enthält, das sie verfolgen wollen, zum Beispiel Vitamin C. Beim spontanen Zusammensetzen der Monomere zu einem Polymer wird das Vitamin C in den kubischen Nanopartikeln eingeschlossen. Anschließend entfernen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Vitamin-C-Moleküle gezielt mithilfe eines Lösungsmittels. Zurück bleibt eine molekular geprägte Polymerhülle, die Löcher in Form der Vitamin-C-Moleküle aufweist – vergleichbar mit künstlichen Antikörpern, die selektiv nur bestimmte Molekülformen erkennen.
Entscheidend für das Ergebnis ist die Kombination dieser speziell geformten Polymere mit einem Nanopartikelkern aus Nickelhexacyanoferrat (NiHCF). Dieses Material lässt sich unter elektrischer Spannung oxidieren oder reduzieren, sobald es mit menschlichem Schweiß oder anderen Körperflüssigkeiten in Kontakt kommt. Sind die Löcher in Vitamin-C-Form unbesetzt, gelangt Flüssigkeit an den NiHCF-Kern und erzeugt ein elektrisches Signal. Rutschen jedoch Vitamin-C-Moleküle in die Löcher, wird der Kontakt von Schweiß oder Körperflüssigkeit mit dem Kern verhindert und das elektrische Signal abgeschwächt. Die Signalstärke gibt somit Aufschluss über die vorhandene Vitamin-C-Menge.
Biosensoren bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Die speziellen Nanopartikel zeichnen sich vor allem durch ihre Vielseitigkeit aus. Sie ermöglichen den Druck von Sensorarrays, die den Gehalt mehrerer Aminosäuren, Metaboliten, Hormone oder Medikamente in Schweiß oder Körperflüssigkeiten messen können. Dazu werden einfach verschiedene Nanopartikel-„Tinten“ in einem Array kombiniert. So druckten die Forscher beispielsweise Nanopartikel, die sich an Vitamin C, die Aminosäure Tryptophan und den Nierenmarker Kreatinin binden, zu einem einzelnen Sensor. Den stellten sie dann in Massenproduktion her. Diese drei Moleküle sind für Studien an Long-COVID-Patienten relevant. Analog dazu entstanden tragbare Sensoren mit Nanopartikeln, die spezifisch für drei verschiedene Antitumor-Medikamente sind. Sie wurden am City of Hope an Krebspatienten getestet.
„Wir konnten das Potenzial dieser Technologie demonstrieren, indem wir die Menge an Krebsmedikamenten im Körper jederzeit aus der Ferne überwachen konnten“, erläutert Gao. „Dies weist den Weg zum Ziel einer personalisierten Dosisanpassung nicht nur bei Krebs, sondern auch bei vielen anderen Erkrankungen.“ Zudem zeigten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass sich die Nanopartikel zum Druck von Sensoren verwenden lassen, die direkt unter die Haut implantiert werden können. Dort können sie den Wirkstoffspiegel im Körper präzise überwachen.
Biosensoren als Massenprodukt ebnen den Weg für personalisierte Medizin
Die Hauptautoren der Arbeit „Printable molecule-selective core–shell nanoparticles for wearable and implantable sensing“ sind die Forschenden Minqiang Wang und Cui Ye vom Caltech. Weitere beteiligte Institutionen sind das Beckman Research Institute am City of Hope sowie die David Geffen School of Medicine an der UCLA. Die Studie wurde durch Mittel diverser Forschungseinrichtungen und Stiftungen unterstützt. Das Kavli Nanoscience Institute am Caltech stellte entscheidende Infrastruktur für das Projekt bereit.
Ein Beitrag von: