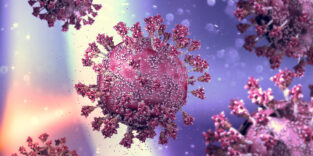Medizin
Top Themen im Bereich Medizin
Moderne Medizintechnik nimmt einen zentralen Stellenwert bei Vorsorge, Diagnose und Therapie einer Vielzahl von Erkrankungen ein. Zudem ist die Medizintechnikbranche zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor herangewachsen. Informieren Sie sich zu Entwicklungen und Trends, angefangen von künstlichen Blutgefäßen über Nanomedizin und MRT bis hin zum vernetzten OP und neuen Laserbehandlungsmethoden.