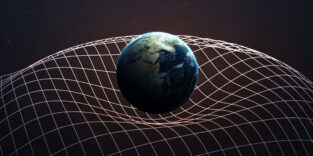Die größten Pannen der Ingenieurgeschichte
Nicht immer laufen Projekte so ab wie geplant. Doch während manche Probleme vorhersehbar sind, beispielsweise weil Kranplätze verdichtet sein müssen, treten in selteneren Fällen auch Ereignisse ein, mit denen niemand rechnet.

Der Schiefe Turm von Pisa – ein weltbekanntes Beispiel für die Folgen fehlerhafter Fundamentplanung und die Herausforderungen der Bauingenieurkunst.
Foto: PantherMedia / DaLiu (YAYMicro)
Ingenieurskunst steht für Präzision, Weitblick und ausgefeilte Planung. Doch selbst das beste Konzept kann unerwartet an seine Grenzen stoßen. Sei es, weil die Verantwortlichen grundlegende physikalische Effekte unterschätzen, die Tragfähigkeit des Untergrunds falsch einschätzen oder sich schlichtweg nicht vorstellen können, wie unvorhersehbar die Realität tatsächlich sein kann. Treffen diese Faktoren aufeinander, können sich daraus spektakuläre und oftmals auch tragische Pannen entwickeln, die der Menschheit noch lange in Erinnerung bleiben – sei es als architektonisches Kuriosum oder als dramatisches Ereignis. Die größten Pannen der Ingenieursgeschichte sind oftmals beides, und auf jeden Fall eine Erwähnung wert.
Inhaltsverzeichnis
- Schiefer Turm von Pisa (ab 12. Jahrhundert)
- Kriegsschiff Vasa (1628)
- Melassekatastrophe von Boston (1919)
- Tacoma Narrows Bridge (1940)
- Millennium Bridge, London (2000)
- Londoner Walkie-Talkie (2014)
- Müngstener Brücke (2015)
- Oroville Dam (2017)
- Flughafen Berlin-Brandenburg (2020)
- Fehler in der Planung: Ein vermeidbares Übel?
Schiefer Turm von Pisa (ab 12. Jahrhundert)
Kaum ein anderes Bauwerk symbolisiert die Folgen fehlerhafter oder mangelhafter Fundamentplanung so deutlich wie der weltbekannte Glockenturm der Kathedrale von Pisa. Bereits im Jahr 1173 begannen die Arbeiten am sogenannten Campanile, welcher ursprünglich für eine Höhe von 56 Metern geplant war. Heute weist das Bauwerk aufgrund der Schräglage nur noch 55,8 m auf.
Die Probleme begannen beim Bau der dritten Etage des Turms, etwa 5 Jahre nach Baubeginn. Der Turm begann sich dabei nach Südosten zu neigen, da die Tragfähigkeit des Untergrunds überschätzt wurde. Dieser besteht dort aus einer etwa 10 m dicken Schicht aus weichem Ton, Sand und angeschwemmten Sedimenten – und das nur 3 m tiefe Fundament schwamm regelrecht oben auf. Die enormen Lasten des massiven Marmorturms drückten demnach immer weiter in den Boden, sodass die Neigung immer stärker wurde. Daraufhin wurden die Bauarbeiten für Jahrzehnte unterbrochen, sodass sich der Boden etwas stabilisieren konnte.
Der Turm von Pisa wurde im 14. Jahrhundert fertiggestellt, blieb aber mit seiner Neigung von etwas mehr als 4 Grad überaus stabil. Ab den 1990er-Jahren drohte das Bauwerk jedoch einzustürzen, sodass umfangreiche Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Erdreich wurde einseitig abgetragen und der Turm mit Gegengewichten und Spannkabeln stabilisiert. Heute beträgt die Neigung ziemlich exakt 3,97 Grad (mit einer Abweichung von etwa 4 m an der Spitze) und der Schiefe Turm von Pisa gilt als dauerhaft gesichert – und ist auch für Touristen wieder zugänglich.
Kriegsschiff Vasa (1628)
Wenn prunkvolle Ästhetik vor Statik und Sicherheit stehen, sind folgenschwere Probleme bereits vorprogrammiert. Genau das verdeutlicht die spektakuläre Havarie des schwedischen Kriegsschiffs Vasa im Jahr 1628. Das imposante Segelschiff war auf Wunsch von König Gustav II konstruiert und erbaut worden, um Schwedens militärische Überlegenheit auf See zu zeigen.
Bei der Planung wurde jedoch spontan ein zweites Deck mit schweren Bronzekanonen ausgestattet, statt einem – ein buchstäblich schwerwiegender Fehler, wie sich später herausstellen sollte. Sogar während der Bauphase zeigten Stabilitätsprüfungen bereits deutliche Schwächen des Kriegsschiffs auf. Bereits vor der Jungfernfahrt gab es Hinweise auf gravierende Stabilitätsprobleme. Zwar fanden damals keine detaillierten Berechnungen oder gründlichen Stabilitätstests wie heute üblich statt, dennoch schwankte das Schiff bereits bedrohlich, als einige Seeleute gleichzeitig zwischen Back- und Steuerbord hin und her liefen.
Die Jungfernfahrt fand aber trotz dieser Ergebnisse statt und die Vasa wurde zum Auslaufen freigegeben. Am 10. August 1628 schaffte das prächtig dekorierte Kriegsschiff keine zwei Kilometer auf dem Wasser, bevor es von einer leichten Windböe zur Seite gedrückt wurde und Wasser durch die offenen Geschützpforten des unteren Decks strömte. Innerhalb kürzester Zeit sank das Prestigeobjekt.
1961 wurde die Vasa geborgen, restauriert und steht nun als historisches Artefakt und mahnende Erinnerung daran, wie fatal sich kleine Planungsfehler (oder das Ignorieren fachkundiger Einwände) auswirken können, im Vasa-Museum in Stockholm.
Lesen Sie dazu: Untergang bei der Jungfernfahrt – das ist Vasa, Schwedens größte maritime Fehlkonstruktion
Melassekatastrophe von Boston (1919)
Melasse als zähflüssiger Sirup aus der Zuckerproduktion ist eigentlich für seine vielseitigen Verwendungszwecke in der Lebensmittelindustrie und in der heimischen Küche bekannt. In größeren Mengen kann das Produkt aber durchaus gefährlich werden und in unserem Fall sogar eine regelrechte Katastrophe herbeiführen – vor allem dann, wenn ein gigantischer Melassetank explodiert.
Genau das passierte am 15. Januar 1919 im Bostoner Stadtteil North End. Ein mit Melasse befüllter Tank mit einem Fassungsvermögen von rund 9 Mio. Litern wurde bei einer Außentemperatur von etwa -14 °C mit einer frischen Lieferung Melasse aus Puerto Rico befüllt. An diesem Tag stieg die Temperatur jedoch rapide auf etwa +5 °C an, wodurch die Fermentation im Inneren des Tanks beschleunigt wurde. Folglich stieg der Innendruck des Melassetanks massiv an und gegen Mittag hielten die Nieten der Belastung nicht mehr Stand. Der Tank barst explosionsartig, und eine bis zu 9 m hohe Sirupwelle raste mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h durch die Straßen. Gebäude wurden zerstört, eine Hochbahntrasse stürzte teilweise ein, und insgesamt kamen bei dem Unglück 21 Menschen ums Leben, während etwa 150 verletzt wurden
Bereits bei der Planung und Wartung des Tanks zeigten sich erhebliche Mängel. Es wurden zum Beispiel zu dünne Stahlplatten verwendet und die schlechten Nietverbindungen verliehen dem gigantischen Tank nicht die notwendige Stabilität. Darüber hinaus wurden Lecks ignoriert und lediglich mit Farbe überstrichen, um die Mängel zu kaschieren. Die juristische Aufarbeitung nach dem Unglück dauerte etwa 6 Jahre – und dabei wurde, entgegen der Behauptung, der Behälter wäre durch einen Bombenanschlag zerstört worden, festgestellt, dass ausschließlich bauliche Mängel zu dieser Katastrophe geführt hatten.
Tacoma Narrows Bridge (1940)
Brücken sind in der Regel bis ins letzte Detail geplante und statisch berechnete Bauwerke, die über Jahrzehnte sicher und stabil ihren Dienst verrichten. Hin und wieder kommt es aber vor, dass grundlegende physikalische Effekte in der Planung nicht berücksichtigt werden, sodass selbst die solideste Konstruktion scheitern kann. Die Tacoma Narrows Bridge im US-Bundesstaat Washington ist ein eindrucksvolles Beispiel – 1940 eröffnet, bereits vier Monate später eingestürzt.
Schon unmittelbar nach der Eröffnung stellten Beobachter besorgt fest, dass sich die Brücke bei leichtem Wind ungewöhnlich stark bewegte und regelrecht in Schwingung geriet. Ursache war ein grundlegender Planungsfehler der Ingenieure, die beim Design der knapp 1.600 m langen Hängebrücke nur auf Statik und Ästhetik achteten, dabei aber die aerodynamischen Einflüsse völlig unterschätzten. Statt einer stabilen Konstruktion wirkte die schmale und zugleich starre Fahrbahnplatte wie ein Flügel im Wind.
Anfang November 1940 führten Windgeschwindigkeiten von knapp 70 km/h dazu, dass das Bauwerk in heftige, unkontrollierte Schwingungen geriet – sogenanntes aeroelastisches Flattern. Diese Bewegungen verstärkten sich zunehmend und rissen letztendlich die gesamte Konstruktion auseinander. Auf Filmaufnahmen ist dokumentiert, wie die gesamte Fahrbahn minutenlang auf- und abwogte, bis sie darauf vollständig kollabierte. Glücklicherweise kamen bei diesem Vorfall keine Menschen ums Leben.
Millennium Bridge, London (2000)
Die Eröffnung neuer Bauwerke wird meist mit großen Erwartungen gefeiert – vor allem, wenn es sich um architektonisch und technisch herausragende Projekte handelt. Genau so ein Prestigeobjekt sollte die Millennium Bridge in London sein, eine filigrane Fußgängerbrücke über die Themse, die pünktlich zum Jahrtausendwechsel eröffnet wurde.

Die Millennium Bridge – ein architektonisches Meisterwerk, das durch unerwartete Schwingungen zur Herausforderung wurde und erst nach aufwendiger Nachrüstung sicher passierbar war.
Foto: PantherMedia / zoltangabor
Die Planer und Ingenieure hatten dabei aber einen Faktor nicht berücksichtigt – die Dynamik großer Menschenmengen. Am Eröffnungstag, dem 10. Juni 2000, strömten tausende Menschen über die 325 m lange Stahlbrücke, um Londons neues Wahrzeichen aus der Nähe zu bestaunen. Bereits nach kurzer Zeit zeigte sich jedoch eine völlig unerwartete Erscheinung. Die Brücke bewegte sich spürbar seitlich hin und her, und Fußgänger berichteten sogar davon, dass es schwierig war, das eigene Gleichgewicht zu halten. Dieses Phänomen wurde später als sogenannte laterale Schwingung identifiziert und trat deshalb auf, weil sich viele Personen im Gleichschritt über die Themse bewegten – und so die Schwingungen noch weiter verstärkten.
Zwar hatten die Ingenieure die Brücke intensiv auf statische Belastungen und klassische Schwingungen geprüft, jedoch die seitlichen Effekte völlig unterschätzt. Damit die Sicherheit gewährleistet werden konnte, wurde die Millennium Bridge bereits nach 2 Tagen geschlossen und musste daraufhin für knapp 2 Jahre aufwendig nachgerüstet und optimiert werden. Heute gilt die beliebte Fußgängerbrücke über die Themse als sicher.
Millennium Tower (2009 bis heute)
Hochhäuser werden häufig als Meisterwerke der Architektur und Ingenieurskunst bewundert und prägen so manche bekannte Skyline. Doch selbst nach der Fertigstellung eines Gebäudes kann noch einiges schief gehen – und beim Millennium Tower in San Francisco lässt sich das sogar wörtlich nehmen. Der rund 200 m hohe Luxusturm mit 58 Stockwerken wurde 2009 fertiggestellt, sank aber bereits kurz darauf ungewöhnlich schnell ab, sodass dieser sich zur Seite neigte.
Die Ursache für dieses Verhalten liegt in der fehlerhaften Fundamentplanung. Statt das Fundament des schweren Stahlbeton-Hochhauses auf tieferliegenden, stabilen Gesteinsschichten zu verankern, entschieden sich die Planer für die kostengünstigere Variante: Eine Betonplatte im lockeren Sand- und Lehmboden der San Francisco Bay. Selbstredend erwies sich diese Entscheidung als fatal, da das Bauwerk bereits wenige Jahre nach der Fertigstellung mehrere Zentimeter tief abgesunken war. Im Jahr 2022 lag der Wert bei über 45 cm und die Spitze des Millennium Towers neigte sich mit steigender Tendenz bereits 66 cm zur Seite.
Zwar wird das Gebäude immer noch als sicher eingestuft, dennoch verursacht die anhaltende Neigung bereits erhebliche Schäden und sorgt ferner für enorme Wertverluste bei den Eigentümern. Die juristische Aufarbeitung dieses Falls zieht sich bereits seit Jahren hin, wobei Eigentümer und Planer um die Verantwortlichkeiten und letzten Endes um die Schadenssumme streiten. Die aktuellen Versuche, das Gebäude durch nachträglich eingebaute Pfähle und Fundamentverstärkungen zu stabilisieren, haben die Neigung bisher nicht stoppen können. Aktuell steht im Raum, einseitig Bodenmaterial zu entnehmen, um die Neigung auszugleichen – wie beim Schiefen Turm von Pisa.
Londoner Walkie-Talkie (2014)
Hin und wieder kommt es vor, dass innovative und kreative Designkonzepte ungeahnte Nebenwirkungen entfalten – und nicht immer sind diese harmloser Natur. Genau das passierte beim Bau des bekannten Hochhauses „20 Fenchurch Street“ in London, besser bekannt als das „Walkie-Talkie“. Das Gebäude wurde vom Architekten Rafael Viñoly entworfen, im Jahr 2014 fertiggestellt – und sorgte schon kurz nach Fertigstellung für unangenehme Schlagzeilen.
Die ungewöhnliche, konkav gekrümmte Fassade des Wolkenkratzers besteht aus einer großflächigen Verglasung, deren ursprünglicher Zweck es war, das Innere des Gebäudes vor zu hoher Sonneneinstrahlung und infolgedessen vor Überhitzung zu schützen. Bei der Planung wurde allerdings ein physikalischer Effekt unterschätzt. Die gekrümmte Glasfläche wirkte wie ein riesiger Brennspiegel und bündelte bei direkter Sonneneinstrahlung das Licht auf einen Punkt.
Bereits kurz nach der Fertigstellung führte dieser Effekt zu kuriosen, aber auch ernsthaften Problemen. Zum Beispiel wurde ein parkendes Fahrzeug durch die große Hitzeentwicklung regelrecht deformiert und sämtliche Kunststoffteile geschmolzen. Darüber hinaus verursachte der gebündelte Lichtstrahl auch in umliegenden Geschäften Schäden, die von stark erhitzten Schaufensterscheiben bis hin zu versengten Fußmatten reichten. Um weiteren Schaden abzuwenden, mussten kurzfristig spezielle Abschirmungen errichtet werden, die den Lichtstrahl blockierten.
Müngstener Brücke (2015)

Müngstener Brücke: Nach millionenteurer Sanierung stellte sich heraus, dass das Gewicht der Passagiere in den Berechnungen fehlte, was zu einer kuriosen Umsteigeprozedur führte.
Foto: PantherMedia / Ulrich Riemer
Die denkmalgeschützte Stahlkonstruktion der mit 107 m höchsten Eisenbahnbrücke Deutschlands war nach über hundertjähriger Nutzung dringend sanierungsbedürftig. Daher entschied sich die Bahn für umfassende Instandsetzungsmaßnahmen, um die statische Tragfähigkeit der Brücke langfristig zu sichern. Nach umfangreichen Arbeiten, die mehrere Jahre dauerten und rund 30 Mio. Euro kosteten, sollte die Brücke endlich wieder für den regulären Bahnverkehr freigegeben werden.
Doch erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wurde klar, dass den verantwortlichen Ingenieuren bei der Berechnung ein folgenschwerer Fehler unterlaufen war. Die Aufsichtsbehörde hatte die sanierte Brücke zunächst nur für ein Gesamtgewicht von maximal 72 Tonnen freigegeben. Unglücklicherweise hatten die Planer dabei lediglich das Eigengewicht der leeren Züge berücksichtigt – die rund 3.000 täglichen Passagiere und ihre Gepäckstücke jedoch schlichtweg vergessen.
In der Folge kam es zu einer kuriosen Situation: Die Fahrgäste mussten vor der Brücke aussteigen, mit Bussen die Serpentinen hinunter ins Tal fahren, die Wupper überqueren und auf der anderen Seite erneut in den wartenden Zug einsteigen – ein umständlicher Umweg von etwa 20 Minuten. Später stellte sich zudem heraus, dass das berechnete maximale Achsgewicht bereits ohne Passagiere überschritten wurde, sodass die Brücke erneut gesperrt und nochmals saniert werden musste.
Oroville Dam (2017)
Im Februar 2017 blickte ganz Kalifornien gebannt auf den Oroville-Staudamm, eines der höchsten und bedeutendsten Bauwerke des US-Bundesstaats. Anhaltender Starkregen hatte den Wasserpegel des Lake Oroville gefährlich ansteigen lassen, und plötzlich zeigte sich, dass eine jahrzehntelange Planung innerhalb kürzester Zeit dramatisch versagen konnte.
Der ursprünglich 1968 fertiggestellte und 235 m hohe Staudamm verfügte über zwei Ablasskanäle, um im Notfall überschüssiges Wasser kontrolliert abzuführen: den Hauptüberlauf und einen Notüberlauf, der eigentlich nie zum Einsatz kommen sollte. Doch genau dieses Notfallszenario trat 2017 ein, und offenbarte sofort gravierende bauliche Schwachstellen. Bereits kurz nach Öffnung des Hauptüberlaufs zeigten sich massive Schäden: Der Betonkanal brach teilweise auf, sodass die enormen Wassermassen unkontrolliert über den darunterliegenden Hang strömten und ihn dramatisch erodierten.
Als dann erstmals in der Geschichte des Damms der Notüberlauf zum Einsatz kam, verschärfte sich die Lage noch weiter. Dieser Überlauf war in der Planung als reiner Notfallkanal vorgesehen und völlig unzureichend gegen Erosion geschützt. Innerhalb kürzester Zeit drohte die Wasserkraft, Teile der Dammstruktur zu destabilisieren, und Behörden sahen sich gezwungen, knapp 190.000 Menschen aus der Umgebung zu evakuieren, da ein vollständiger Dammbruch befürchtet wurde.
Erst durch hektische Notreparaturen und mit viel Glück gelang es den Ingenieuren, das Schlimmste abzuwenden. Die Folge waren jedoch hohe Reparaturkosten in dreistelliger Millionenhöhe sowie langwierige juristische und technische Untersuchungen, welche eklatante Fehler bei Planung, Konstruktion und Wartung ans Tageslicht brachten.
Flughafen Berlin-Brandenburg (2020)
Kaum ein Bauprojekt steht in Deutschland so symbolisch für misslungene Planung und mangelhafte Bauausführung wie der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER). Ursprünglich sollte der Willy-Brandt-Flughafen bereits im Jahr 2011 in Betrieb genommen werden, doch aus Monaten wurden Jahre und aus Jahren ein ganzes Jahrzehnt an Verzögerungen und Pannen – und der BER erlangte weltweite Bekanntheit, im negativen Sinne. Im Oktober 2020, 9 Jahre später als geplant, konnte der Flughafen endlich eröffnet werden.
Eigentlich sollte das Projekt BER eines der modernsten Flughäfen Europas hervorbringen, doch endete das Vorhaben in einem unüberschaubaren Planungschaos, welches vor allem der unübersichtlichen Koordination der zahlreichen Planungsbüros sowie einer mangelnden Bauaufsicht geschuldet war. Darüber hinaus wurden während der Bauphase (und 9 Jahre sind in dieser Hinsicht eine lange Zeit) gleich mehrere Vorschriften und Anforderungen geändert. Hinzu kamen technische Mängel wie nicht funktionierende Brandschutzanlagen, fehlerhafte Verkabelungen, falsch berechnete Fluchtwege und eine unzureichende Belüftungsanlage, die mehrfach komplett umgeplant und nachgerüstet werden musste.
Die zahlreichen Probleme am BER führten zu einer massiven Kostenexplosion – von ursprünglich geplanten 2 Mrd. Euro auf mehr als 7. Zwar ist der Flughafen heute erfolgreich in Betrieb und bewältigt zuverlässig den regulären Flugverkehr, dennoch sorgt der Name „BER“ für Schmunzeln und Kopfschütteln – in der Bundesrepublik sowie weit über die Grenzen hinaus.
Fehler in der Planung: Ein vermeidbares Übel?
Irren ist menschlich, und Fehler passieren überall. Doch in manchen Bereichen drohen ernsthafte Konsequenzen, die nicht nur die Projektkosten in schwindelerregende Höhen treiben, sondern häufig auch Menschenleben in Gefahr bringen. Die Geschichte technischer Großprojekte zeigt immer wieder, dass erfolgreiche Planung weit mehr als gute Ideen erfordert. Detaillierte Bestandsaufnahmen, exakte Baugrunduntersuchungen und präzise Materialanalysen gehören ebenso dazu wie eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren, Architekten, ausführenden Firmen und Bauherren.
Gerade bei komplexen Projekten hängt vieles davon ab, wie transparent kommuniziert und wie verantwortungsvoll Entscheidungen getroffen werden. Moderne Werkzeuge wie Building Information Modeling (BIM) und digitale Prozesssteuerung können diese Zusammenarbeit erleichtern – aber nur, wenn sie konsequent genutzt werden.
Ein Beitrag von: