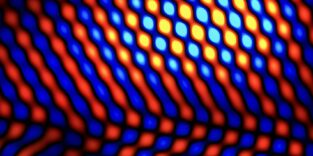TU Bergakademie Freiberg: Brachial-Physik im Lehrbergwerk
Forscher der TU Bergakademie Freiberg wollen mit Sprengstoff ultraharte Werkstoffe entwickeln. Mit Stiftermitteln hat die Uni dazu ein Schockwellenlabor eingerichtet – 150 m unter Tage. Dort zwingen die Forscher Nitrid-Kristallgitter durch Detonations-Druck in beständigere Formationen. Diese werden hart wie Diamant, aber hitzebeständiger.
„Glück auf!“ Nach der standesgemäßen Begrüßung im Lehr- und Forschungsbergwerk „Reiche Zeche“ der TU Bergakademie Freiberg steuert Kevin Keller sofort die Umkleide an. Schnell sind matt-grüne Jacke und Hosen übergestreift, Schuhe gegen Gummistiefel getauscht und der Helm samt Leuchte aufgesetzt.
„Unten wird es kalt und feucht“, warnt der junge Mineraloge. Er fährt regelmäßig in den Berg ein, dessen Silberadern die Region einst aufblühen ließen.
Doch Keller sucht keine Edelmetalle. Im Team seines Professors Gerhard Heide ist er neuen Materialien auf der Spur, die in der Natur so nicht vorkommen. Der Schlüssel dazu liegt 150 m unter Tage.
Im Aufzug geht es hinab. Zu viert, dicht gedrängt. Hinter der Gitterwand zieht der graue Fels vorbei. Taufrische Luft zieht hinein. Wasser tropft. Keine Minute später öffnet sich die Tür zur ersten Sohle. Arbeiter werkeln hier an einem zweiten Aufzugschacht, der tiefere Stollen erschließen soll. Denn die TU baut ihre Forschung und Lehre unter Tage aus. Der globale Rohstoffhunger lässt die Bergbautradition aufleben. Auch kleinere Lagerstätten im Erzgebirge und der Lausitz könnten dank moderner Erkundungs- und Simulationsmethoden interessant werden.
TU Bergakademie Freiberg: Sprenglabor unter Tage ist für 50 kg Sprengstoff ausgelegt
Heides Team erkundet nicht. Es sprengt, um ultraharte Hightech-Werkstoffe zu erzeugen. Dass sie das dürfen, liege daran, dass hier unten Bergrecht gelte, erklärt Keller, während er durch den matt beleuchteten Stollen stapft. Immer wieder zieht er den Kopf ein, weicht Felsvorsprüngen aus. Einen Kilometer und einige Tunnelgabelungen später ist das „Schockwellenlabor“ erreicht.
Mit Stiftermitteln der Familie des früheren TU-Wissenschaftlers Erich Krüger wurde dieses Labor dem Fels in den letzten Jahren abgetrotzt. Eine Höhle von 6 m x 6 m Grundfläche, gut 5 m hoch. „Es ist für Sprengungen mit bis zu 50 kg Sprengstoff ausgelegt“, berichtet Keller. Die gewaltigen Druckwellen hätten so genug Platz zu entspannen.
Der Sprengdruck zwingt chemische Bindungen in neue Formationen
„Wir sprengen hier nicht, um etwas zu zerstören, sondern um Neues zu schaffen“, erklärt Forschungsleiter Gerhard Heide. Dafür wird Sprengstoff direkt über Materialproben gezündet. Für einige Mikrosekunden sind diese je nach Art und Menge des Sprengstoffs Drücken bis 100 Gigapascal (GPa) ausgesetzt. Schon bald sollen es 300 GPa sein. Zum Vergleich: Im Erdkern herrschen 362 GPa. „Würden Sie den komprimierten Eiffelturm auf einem Finger balancieren, betrüge der Druck zirka 10 GPa“, so der Professor.
Der brachiale Detonationsdruck zwingt die chemischen Bindungen der Materialproben in neue, äußerst beständige Formationen. Die Atombindungen im Kristallgitter rücken enger zusammen – die Werkstoffe werden härter. Keller erforscht Aluminium-Nitrid. Kollegen widmen sich Silizium-Nitrid, Bor-Nitrid oder Wolfram-Karbid. Auch das Kompaktieren von Grafit zu Diamantpulver ist angedacht.
Vorerst versprechen ultraharte Nitride das größte Potenzial. „Bei Geothermie-Bohrungen in hartem Gestein sind Bohrköpfe ein echter Kostenfaktor“, sagt Heide. Die Branche sei auf der Suche nach widerstandsfähigen, hitzebeständigeren Beschichtungen. Optische Technologien und Werkzeugbau brauchten ebenfalls beständigere Hartstoffe.
Heide ist überzeugt, sehr nah an richtigen Lösungen zu sein. Während Diamant bei etwa 800 °C verglühe, hielten schockwellengehärtete Nitride Temperaturen bis 1200 °C stand.
TU Bergakademie Freiberg will Schockwellensynthese mit Bergbausprengstoff umsetzen
Noch bewegt sich diese Schockwellen-Technik im Frühstadium. „Wir können pro Sprengung nur etwa ein Gramm synthetisieren“, räumt Heide ein. Verglichen mit Über-Tage-Laboren, die im mg-Bereich arbeiten, sei das ein Riesenfortschritt. Doch für Industrieeinsätze reicht das nicht. Zumal der bisher genutzte Plastiksprengstoff einige Hundert Euro pro Kilo kostet.
Ein Ziel der Freiberger ist es deshalb, die Schockwellensynthese mit Bergbausprengstoff zu realisieren, der schon zu Kilopreisen von einigen Euro zu haben ist.
Daneben feilen sie an Versuchsaufbau und Sprengtechnik. Die Proben – Nanopulver der jeweils eingesetzten Nitride – füllen die Forscher am Institut unter Schutzgasatmosphäre in Oblaten – große Kupferkapseln. Diese lassen sie in massive Edelstahlzylinder rutschen, in die sie dann schwere Stahlkolben einlassen. Die derart ummantelte Probe passt exakt in die mittige Aussparung einer tortengroßen, massiven Stahlplatte.
Keller demonstriert den Versuchsaufbau auf dem Boden des Sprenglabors kniend. Etwa in der Raummitte ist ein Sandbett eingelassen, auf dem die Probe ruht. „Obendrauf stellen wir den eigentlichen Sprengsatz“, erklärt er.
Gesprengt wird jeweils mit zwei unterschiedlich schnellen Sprengstoffen. Diese bringen die Forscher in ein schwarzes PVC-Rohr ein, das ein Füllkörper nach oben glockenförmig bis auf eine stiftdicke Öffnung verjüngt. „Hier wird der Zünder eingesteckt“, sagt Keller. Durch Glockenform und unterschiedliche Geschwindigkeit erreichen die Forscher, dass die an sich kugelförmige Druckwelle sich fast eben ausbreitet. Mit 8 km/s prallt sie auf eine mehrere Millimeter dicke Stahlplatte im PVC-Rohr und katapultiert diese abwärts auf den Probenhalter. „Die Proben selbst durchläuft die Schockwelle mit bis zu 5 km/s“, erklärt er. Die ausgefeilte Verkapselung gewährleistet, dass sich das Pulver später bergen lässt.
Ehe Bergwerks-Sprengmeister Stephan Leibelt oder der sprengberechtigte TU-Forscher Thomas Schlothauer zünden, wird das Sprenglabor mit einer gut 20 cm starken Stahltür verschlossen. Die Sprengung selbst verfolgen die Forscher kaum 50 m weit entfernt im Kontrollraum. Hier laufen auch sämtliche Messdaten ein, die ein dichtes Sensornetzwerk während und nach der Detonation im Schockwellenlabor aufzeichnet. „Der Rechner ist online“, sagt Keller, „wir können die Daten direkt ins Institut weiterleiten“. Nach einem Luftaustausch im Labor können sie dann die Proben einsammeln.
Die Materialanalysen führen Keller und Kollegen am Institut für Mineralogie per Röntgendiffraktometrie, Infrarotspektroskopie und am Rasterelektronenmikroskop durch. „Auf jede Sprengung folgen wochen- und monatelange Auswertungen“, berichtet er. Die Forscher ermitteln so, welche Randparameter ihre Druckwellensynthesen wie beeinflussen.
TU Bergakademie Freiberg will Sprenglabor für angewandte Forschung nutzen
„Wir sind zwar nicht mehr im Stadium der Grundlagenforschung, doch gerade mit Blick auf die Synthese größerer Materialmengen gibt es noch viele offene Fragen“, so Heide. Bisher reichten die synthetisierten Hartstoffe nur für Pilot-Anwendungen – etwa für die Politur von Präzisionslinsen, Prototypen von Bohr- und Fräsköpfen oder feinen Silizium-Sägen oder für weiterführende wissenschaftliche Experimente. Auch die Erzeugung von Nanoteilchen aus hochfestem Material (etwa Wolfram-Karbid) mithilfe von Sprengstoff sei angedacht. „Wenn wir das Pulver sintern, könnten die Nanopartikel bisher auftretende Hohlräume füllen“, erklärt er. Auch das führe zu ultraharten Werkstoffen. Daneben gibt es Überlegungen, Metallwerkstoffe durch Schockwellen zu verbinden und umzuformen.
Das Unter-Tage-Labor biete jede Menge Möglichkeiten. Heide kann sich gut vorstellen, es in Kooperationen mit Industriepartnern künftig für die angewandte Forschung zu nutzen. Schon jetzt würden sich Kollegen aus Fertigungstechnik und Metallurgie an ihn wenden, die Prozesssimulationen zum Explosionsumformen und -schweißen verifizieren wollen. „In unserem Schockwellenlabor können sie ihre Prozesse um Größenordnungen schneller erproben als in Hochgeschwindigkeitswalzen und -pressen und daran nachvollziehen, ob die Annahmen ihrer mathematischen Modelle stimmen“, berichtet er.
Als das Labor im letzten Juli eingeweiht wurde, hatte Heide noch keine Gedanken an Grundlagenfragen der Ingenieurtechnik verschwendet. Dabei ist es nicht geblieben. Auch Geologen sind an ihn herangetreten – mit noch grundsätzlicheren Fragen. „Jetzt, wo wir für Mikrosekunden diese enormen Drücke erzeugen können, lässt sich experimentell nachvollziehen, was im Erdkern los ist“, sagt er. Dass er aus Eisen-Nickel bestehe, sei eine theoretische Annahme. „Wir können jetzt systematisch Materialien unter diesen Drücken testen“, freut sich der Professor auf viele donnernde Versuchsreihen – und möglicherweise die eine oder andere Überraschung.
Ein Beitrag von: