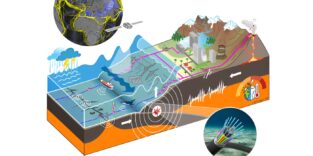Berufskrankheit: Pestizide verursachen Parkinson
Pestizide können Parkinson auslösen. Bauern und die Landbevölkerung müssen deshalb besser geschützt werden.

Pestizide können Parkinson auslösen. Bauern und Landbevölkerung müssen deshalb besser geschützt werden. Die Erkankung ist mittlerweile als Berufskrankheit anerkannt.
Foto: panthermedia.net / Günter Fischer
Inhaltsverzeichnis
- An Parkinson Erkrankte sind irgendwann auf Pflege angewiesen
- Wirkstoffe in Paraquat und Rotenon sind Nervengifte und schädigen das Gehirn
- Parkinson: Erhöhtes Risiko in 500 m Nähe zu einem gespritzten Feld
- Das Gift wird beim Einatmen aufgenommen oder dringt durch die Haut ein
- Berufsgenossenschaft ermutigt Betroffene zur Prüfung ihres Falls
- Besserer Schutz der Landbevölkerung und der Landwirte gefordert
Viele Landwirte überraschte die Post. 2024 schrieb die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau alle Versicherten der Landwirtschaftlichen Krankenkasse an, die an Parkinson erkrankt sind. In mittlerweile über 8000 Fällen will sie prüfen, ob Pestizide am Ausbruch des Nervenleidens schuld sind.
Das hat einen handfesten Grund: Nach über zehn Jahren intensiver Arbeit hat der Ärztliche Sachverständigenbeirat, der als unabhängiges Gremium vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales beauftragt wird, 2024 empfohlen, pestizidbedingte Parkinsonerkrankungen als Berufskrankheit anzuerkennen. „Die Datenlage lässt daran keinen Zweifel“, sagt die Arbeitsmedizinerin Monika Rieger vom Universitätsklinikum Tübingen, die zugleich Mitglied im Ärztlichen Sachverständigenbeirat ist. Bis zur formalen Aufnahme in die Verordnung der Berufskrankheiten werden die Fälle nun bereits „wie eine Berufskrankheit“ behandelt. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie und die Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen begrüßen den Schritt.
An Parkinson Erkrankte sind irgendwann auf Pflege angewiesen
Morbus Parkinson ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Sie lässt Hände zittrig und Bewegungen schleppend werden. Im Laufe der Zeit kommen Probleme mit dem Gleichgewicht und dem Schlaf hinzu. Die Erkrankten werden nicht selten depressiv und können sich schlechter konzentrieren. Niemand stirbt an Parkinson, aber die meisten sind nach Jahren irgendwann auf Pflege angewiesen. An eine Arbeit in der Landwirtschaft ist am Ende nicht mehr zu denken.
Weltweit nimmt die Parkinsonerkrankung seit den 1950er-Jahren ständig zu. An der Überalterung westlicher Zivilisationen allein liege das nicht, stellt der Neurologe Stephan Bohlhalter vom Luzerner Kantonsspital klar, der zum pestizidbedingten Parkinsonsyndrom forscht. Die Zunahme der Erkrankung fällt mit dem steigenden Verbrauch an Pflanzenschutzmitteln zusammen. Internationale Daten zeigen: Unter Landwirten tritt die Krankheit häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung. Frankreich und Italien haben das Leiden deshalb schon 2012 bzw. 2008 als Berufskrankheit anerkannt. Neben den Landwirten gibt es weitere betroffene Berufsgruppen wie Gartenbauer und Mitarbeiter in den Herstellungsbetrieben. Von Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeitern, die regelmäßig beim Spritzen und der Ernte helfen, ist bisher noch gar nicht gesprochen.
Wirkstoffe in Paraquat und Rotenon sind Nervengifte und schädigen das Gehirn
Für viele Landwirte war der Brief der Berufsgenossenschaft eine Überraschung. Die meisten ahnen zwar, dass Pflanzenschutzmittel ungesund sind, aber dass sie Parkinson als Nervenleiden begünstigen, ist den wenigsten klar. Über die Luft und die Haut dringen die Pflanzenschutzmittel in ihren Körper ein. Nicht wenige Wirkstoffe sind Nervengifte für Insekten und können auch im Gehirn direkt die dopaminergen Nervenzellen schädigen, deren Verlust schließlich Parkinson auslöst. Gut belegt ist das etwa für das Unkrautvernichtungsmittel Paraquat und für Rotenon, ein biologisches Mittel gegen Läuse. „Es gibt aber nicht nur einen Mechanismus. Verschiedene Pflanzenschutzmittel tragen auf unterschiedlichen Wegen etwa auch über oxidativen Stress zur Zellschädigung bei“, betont Rieger.
Die härtesten Belege, dass viele Pflanzenschutzmittel den Ausbruch des Parkinson-Leidens begünstigen, kommen aus Kalifornien. Der Bundesstaat hat seit 1974 ein Gesetz, das Landwirte zur Meldung verpflichtet, was sie wann und wo gespritzt haben. Diese Datensammlung ist weltweit einzigartig.
Parkinson: Erhöhtes Risiko in 500 m Nähe zu einem gespritzten Feld
Die gebürtige Deutsche, Beate Ritz, heute Professorin für Umweltmedizin an der University of California, zog die Daten ab der Jahrtausendwende heran, um zu klären, ob Pestizide mit Parkinson zu tun haben. Ihre Forschungen haben jeden Zweifel zerstreut: „Wenn man im Umkreis von 500 m von gespritzten Feldern wohnt oder arbeitet, hat man ein 50 % bis 100 % erhöhtes Risiko, an Parkinson zu erkranken. Allein in Kalifornien betrifft das Tausende Personen jedes Jahr“, sagt sie.
900 unterschiedliche Pflanzenschutzmittelwirkstoffe seien in den letzten 50 Jahren in Kalifornien ausgebracht worden. 53 unterschiedliche Substanzen schädigen die Nerven nachweislich derart, dass sie das Risiko für Parkinson erhöhen, stellte Ritz jüngst fest. Darunter sind sogar auch Mittel, die im Bioanbau bewährt sind, wie Kupfersalze.
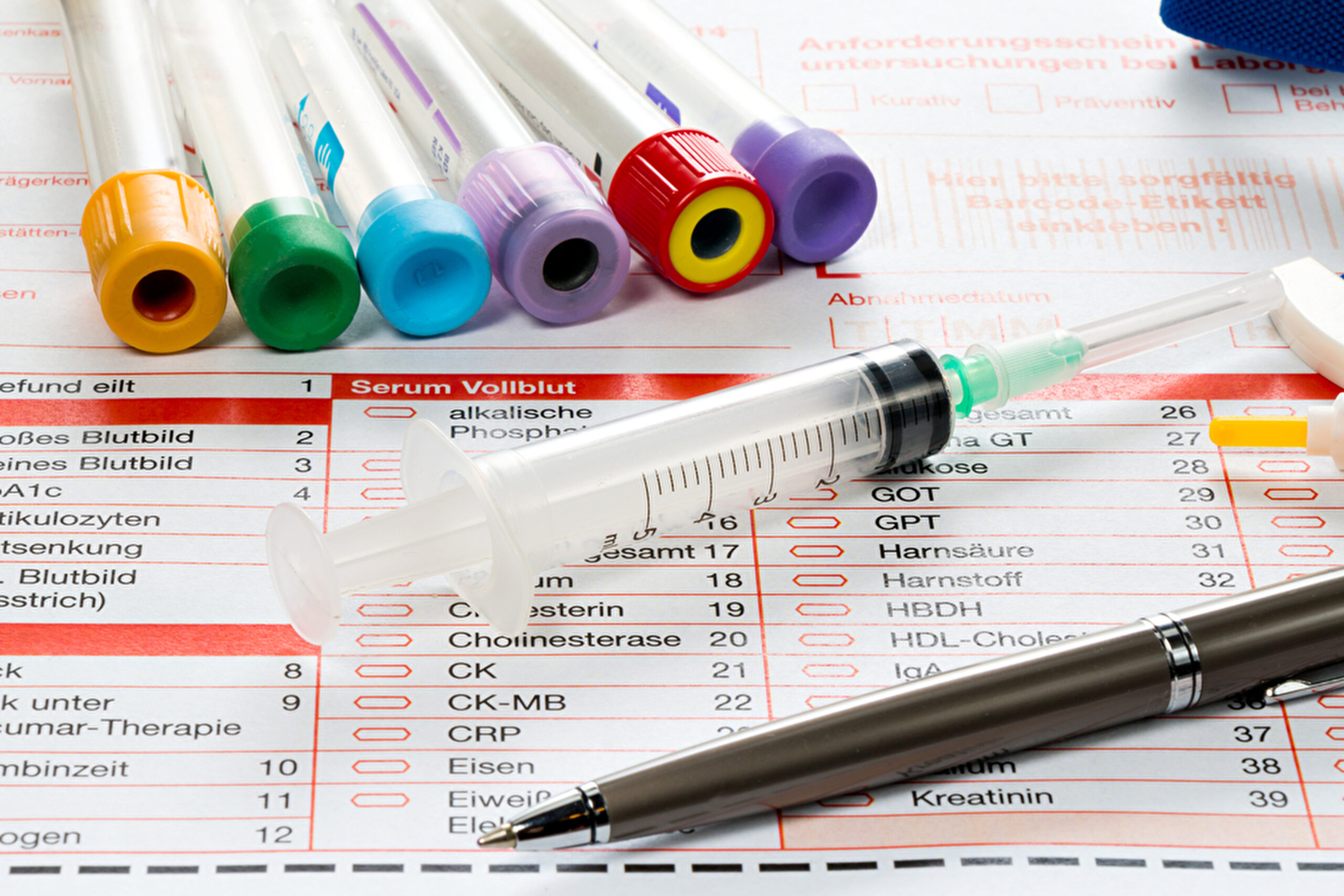
Über die Luft und die Haut dringen die Pflanzenschutzmittel in den Körper ein. Nicht wenige Wirkstoffe sind Nervengifte für Insekten. Im Gehirn können sie direkt die dopaminergen Nervenzellen schädigen, deren Verlust schließlich Parkinson auslöst.
Foto: PantherMedia / fotoquique
Das Gift wird beim Einatmen aufgenommen oder dringt durch die Haut ein
„Die Leute denken bei Pestiziden meistens an ihr Obst und Gemüse. Aber wir sehen, dass es ein chronisches Risiko über die Luft gibt, die Menschen einatmen, wenn sie sich regelmäßig in der Nähe von gespritzten Feldern aufhalten“, mahnt die Umweltmedizinerin und stellt zugleich klar: „Es ist sicher nicht der einmalige Kontakt, der nervenkrank macht.“ Es ist die Belastung über viele Jahre.
Deshalb können nur solche Fälle unter den Landwirten eine Berufskrankheit anerkannt bekommen, die nachweislich mindestens 100 Tage mit Insektiziden, Herbiziden oder Fungiziden Umgang hatten. Genau dieser Nachweis dürfte allerdings schwierig werden. Nicht wenige Betroffene sind inzwischen so erkrankt, dass sie ihren Beruf aufgeben mussten oder nurmehr eingeschränkt arbeiten. Welche Pflanzenschutzmittel sie in jungen Jahren im offenen Traktor auf den Acker ausfuhren, oft schlecht geschützt und ganz gelb von den Spritzmitteln, wie sich ein betroffener Bauer erinnert, wissen viele sicher nicht mehr. Solche Unterlagen müssen auf dem Hof hierzulande nur drei Jahre lang aufbewahrt werden.
Berufsgenossenschaft ermutigt Betroffene zur Prüfung ihres Falls
Die Berufsgenossenschaft ermutigte die Erkrankten Ende 2024 dennoch zur Prüfung ihres Falls: Viele würden das Verfahren scheuen und leichtfertig verzichten. Auch wenn keine entsprechenden Nachweise mehr vorhanden sind und sich die Personen nicht mehr an Handelsnamen oder gar Wirkstoffe der Produkte erinnern, ließe sich in der Zusammenarbeit klären, welche weiteren Informationsquellen herangezogen werden könnten.
Einen Vorgeschmack gibt die Situation in Frankreich: Dort sind seit 2012 jedes Jahr zwischen 20 und 52 Fälle als berufskrank anerkannt worden. In Summe sind es knapp 300 unter 1,2 Mio. Beschäftigten im Landwirtschaftssektor. Im deutschen Sozialrecht hätte eine Akzeptanz als Berufskrankheit weitreichende Folgen: Betroffene können Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung, aber auch der Berufsgenossenschaft bekommen. Neben Rentenzahlungen können das auch die Kosten für eine Haushaltshilfe und ähnliche Unterstützungen sein.
Besserer Schutz der Landbevölkerung und der Landwirte gefordert
Schon jetzt ist klar, dass der Status des pestizidbedingten Parkinsons als Berufskrankheit auch die Forderung nach einem besseren Schutz der Landbevölkerung und der Landwirte aufwerfen wird: Das sei notwendig, fordert etwa die Deutsche Gesellschaft für Neurologie. Landwirte könnten künftig Ganzkörper-Schutzanzüge, Schutzhandschuhe, Atemschutz und Brille tragen, wenn sie mit Spritzmitteln hantieren oder im Traktor sitzen.
Beate Ritz rät Personen, die im Umfeld von Feldern leben, arbeiten oder zur Schule gehen, davon ab, im Freien spazieren zu gehen oder das Fenster zu öffnen, wenn gespritzt wird. Solche Ratschläge, die sonst nur bei einem Brand in einer Chemiefabrik ausgegeben werden, entblößen, wie nötig das gescheiterte Pestizidgesetz der EU zur Reduktion der Pflanzenschutzmittel zum Schutz der Bauern selbst gewesen wäre.
Ein Beitrag von: