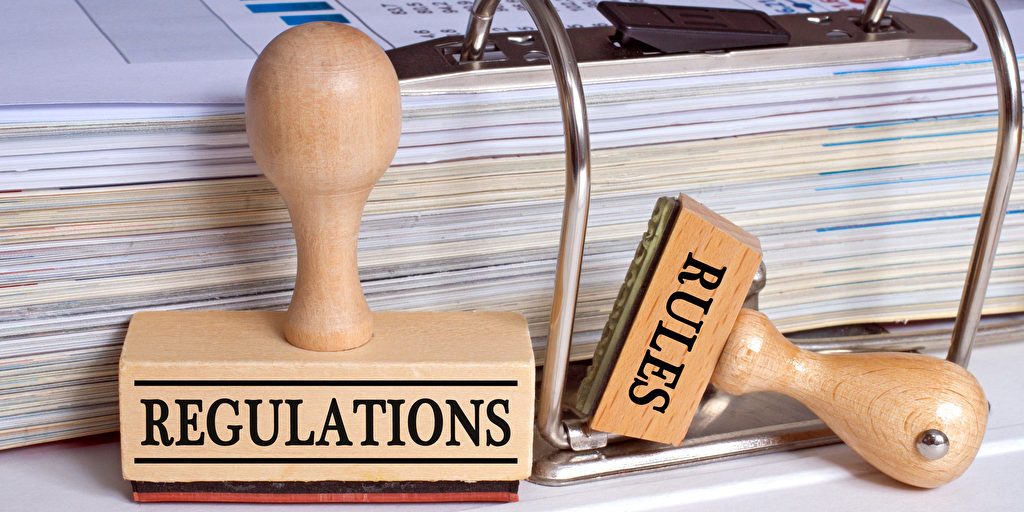Sensoren aus „gefrorenem Rauch“ spüren Formaldehyd besser auf als gängige Systeme
Formaldehyd in der Raumluft ist gesundheitsschädlich, kann sogar Krebs erzeugen. Forschende haben nun einen Sensor entwickelt, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Luftqualität in Innenräumen sehr viel besser kontrollieren kann als alle gängigen Systeme.

Der Sensor aus gefrorenem Rauch spürt Formaldehyd besser auf als die meisten gängigen Geräte.
Foto: PantherMedia / designer491
Formaldehyd kann als Klebstoffbestandteil in Holzwerkstoffen enthalten sein, wie etwa in Bauprodukten und Möbeln. Gast es aus, reizt es die Schleimhaut der Augen und der oberen Atemwege, außerdem gilt es als krebserregend. Forschende aus Cambridge haben nun einen Sensor aus „gefrorenem Rauch“ entwickelt, der sehr viel sensibler auf Formaldehydkonzentrationen in der Raumluft reagiert. Dabei kommen Techniken der künstlichen Intelligenz zum Einsatz.
Hochempfindlicher Sensor auf Basis von Aerogelen
Forschende der Universität Cambridge haben einen hochempfindlichen Sensor auf der Basis von Aerogelen entwickelt. Von „gefrorenem Rauch“ spricht Tawfique Hasan von der University of Cambridge, wenn er das Ausgangsmaterial für den Sensor beschreiben soll. Die hochporösen Materialien ermöglichen es dem Sensor, Formaldehyd, einen in Innenräumen weit verbreiteten Schadstoff, bei Konzentrationen von nur acht Teilen pro Milliarde in Echtzeit zu erkennen. Diese Fähigkeit übertrifft die Empfindlichkeit der meisten existierenden Luftqualitätssensoren bei weitem.
Zusätzlich verwendete das Forschungsteam Techniken der künstlichen Intelligenz zur Datenanalyse. Sie helfen dabei, den spezifischen „Fingerabdruck“ von Formaldehyd bei Raumtemperatur zu erkennen. Darüber hinaus zeichnen sich diese Proof-of-Concept-Sensoren durch einen minimalen Stromverbrauch aus, was sie ideal für den Einsatz in tragbaren Geräten und im medizinischen Bereich macht. Darüber hinaus kann das Konzept auf die Detektion verschiedener gefährlicher Gase erweitert werden.
VOC Hauptursache für Luftverschmutzung in Innenräumen
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) tragen wesentlich zur Luftverschmutzung in Innenräumen bei und können bei hohen Konzentrationen Symptome wie tränende Augen, Brennen in Augen und Hals sowie Atembeschwerden hervorrufen. Menschen mit Asthma können besonders empfindlich reagieren und Asthmaanfälle erleiden. Eine langfristige Exposition kann auch das Risiko für bestimmte Krebsarten erhöhen.
Formaldehyd, ein weit verbreitetes VOC, stammt häufig aus Haushaltsprodukten wie Spanplatten (z. B. MDF), Tapeten, Farben oder Kunststoffen. Obwohl die Formaldehydemissionen aus diesen Produkten in der Regel gering sind, können sie sich im Laufe der Zeit ansammeln, insbesondere in Garagen, wo Farben und andere Formaldehyd emittierende Produkte häufig gelagert werden.
Ein Fünftel aller britischen Haushalte mit auffälligen Formaldehydkonzentrationen
Laut einem 2019 veröffentlichten Bericht der Kampagnengruppe Clean Air Day wiesen 20 % der Haushalte im Vereinigten Königreich erhöhte Formaldehydwerte auf, wobei 13 % der Wohnungen über dem von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Höchstwert lagen.
„VOCs wie Formaldehyd können bei längerer Exposition selbst bei niedrigen Konzentrationen zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen, aber die derzeitigen Sensoren haben nicht die Empfindlichkeit oder Selektivität, um zwischen VOCs zu unterscheiden, die unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben“, sagte Professor Tawfique Hasan vom Cambridge Graphene Centre, der die Forschung leitete.
Das sind die Grenzwerte in Deutschland
In Deutschland dürfen Holzwerkstoffe wie Spanplatten nur verkauft werden, wenn sie unter bestimmten Bedingungen eine Formaldehydkonzentration von maximal 0,1 ppm (entsprechend 124 µg/m³) in der Raumluft verursachen. Diese in der Chemikalien-Verbotsverordnung festgelegte Regelung gilt inzwischen auch für andere Holzprodukte und Möbel.
Die EU hat dagegen strengere Vorschriften erlassen: Möbel und Produkte auf Holzwerkstoffbasis dürfen europaweit nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie die Raumluft nicht mit mehr als 0,05 ppm Formaldehyd (62 µg/m³) belasten. Für andere Materialien wie Textilien, Leder, Kunststoffe und Baustoffe hat die EU einen Grenzwert von 80 µg/m³ festgelegt. Ausnahmen gelten für Produkte, in denen Formaldehyd natürlich vorkommt oder die ausschließlich außerhalb der Gebäudehülle verwendet werden.
Darüber hinaus hat der Ausschuss für Innenraumrichtwerte des Umweltbundesamtes 2016 einen Richtwert von 0,1 mg/m³ (100 µg/m³) für die Luftqualität in Innenräumen empfohlen.
Aerogele machen den Sensor hochsensibel
Zurück zu dem Sensor aus gefrorenem Rauch der Universität Cambridge. Zhuo Chen, der Erstautor der Studie äußerte sich ihm folgendermaßen: „Wir wollten einen Sensor entwickeln, der klein ist und wenig Strom verbraucht, aber selektiv Formaldehyd in niedrigen Konzentrationen nachweisen kann“.
Das Ergebnis: Sensoren auf Basis von Aerogelen. Diese ultraleichten Materialien, die oft als „flüssiger Rauch“ bezeichnet werden, bestehen zu über 99 Prozent aus Luft. Durch ihre offene Struktur können Gase leicht hindurchströmen. Durch die präzise Anpassung von Form und Morphologie der Poren können Aerogele als effiziente Sensoren eingesetzt werden.
Optimierung der Aerogele zusammen mit der Universität Warwick
Um die Empfindlichkeit gegenüber Formaldehyd zu erhöhen, hat das Forschungsteam der Universität Cambridge mit Kollegen der Universität Warwick zusammengearbeitet und die Zusammensetzung und Struktur der Aerogele optimiert. Die Aerogele wurden zu Fäden geformt, die etwa dreimal so dick sind wie ein menschliches Haar.
Darüber hinaus verwendeten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Technik, bei der Linien aus einer Graphenpaste, einer zweidimensionalen Form von Kohlenstoff, dreidimensional gedruckt wurden. Durch anschließendes Gefriertrocknen der Graphenpaste entstanden Poren in der endgültigen Struktur des Aerogels. Außerdem integrierten sie winzige Halbleiter, so genannte Quantenpunkte, in die Aerogele, um deren Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Sensoren messen selbst kleine Formaldehyd-Konzentrationen in der Raumluft
Die von dem Forschungsteam entwickelten Sensoren können Formaldehyd in sehr niedrigen Konzentrationen von acht Teilen pro Milliarde nachweisen, was nur 0,4 Prozent des Wertes entspricht, der in Großbritannien als unbedenklich für Arbeitsplätze gilt. Wie geplant, arbeiten die Sensoren zudem effektiv bei Raumtemperatur und zeichnen sich durch einen minimalen Stromverbrauch aus.
„Herkömmliche Gassensoren müssen erhitzt werden, aber aufgrund der Art und Weise, wie wir die Materialien entwickelt haben, funktionieren unsere Sensoren unglaublich gut bei Raumtemperatur, so dass sie zwischen 10 und 100 Mal weniger Strom verbrauchen als andere Sensoren“, so Chen.
Künstliche Intelligenz verbessert die Selektivität
Um die Genauigkeit der Sensoren zu erhöhen, integrierten die Forscher Algorithmen des maschinellen Lernens. Diese sind darauf spezialisiert, die spezifischen Muster verschiedener Gase zu erkennen, so dass die Sensoren Formaldehyd präzise von anderen flüchtigen organischen Verbindungen unterscheiden können.
„Bestehende VOC-Detektoren sind stumpfe Instrumente – man erhält nur eine Zahl für die Gesamtkonzentration in der Luft“, so Hasan. „Durch den Bau eines Sensors, der spezifische VOCs in sehr niedrigen Konzentrationen in Echtzeit erkennen kann, können Haus- und Geschäftsbesitzer ein genaueres Bild der Luftqualität und möglicher Gesundheitsrisiken erhalten“.
Auch für andere flüchtige Verbindungen geeignet?
Das Forschungsteam geht davon aus, dass sich mit der gleichen Methode Sensoren für verschiedene flüchtige organische Verbindungen entwickeln lassen. Ein Gerät von der Größe eines herkömmlichen Kohlenmonoxid-Detektors könnte theoretisch mehrere Sensoren enthalten, die gleichzeitig Informationen über verschiedene gefährliche Gase liefern.
Professor Julian Gardner von der Universität Warwick, einer der Autoren der Studie, erklärt: „In Warwick arbeiten wir an der Entwicklung einer kostengünstigen Multisensor-Plattform, die neue Aerogelmaterialien verwendet. Diese Plattform kann, unterstützt durch KI-Algorithmen, verschiedene flüchtige organische Verbindungen identifizieren“. Chen fügt hinzu: „Indem wir hochporöse Materialien als Sensorelemente verwenden, eröffnen wir völlig neue Wege, um gefährliche Substanzen in unserer Umwelt aufzuspüren“.
Ein Beitrag von: