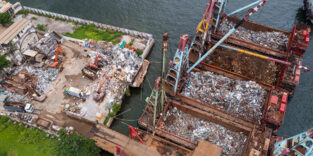Antike Seefahrt: So bauten Römer und Griechen ihre Schiffe
Schiffbau der Antike: Wie konstruierten die Griechen und Römer ihre Schiffe? Blick auf alte Techniken und Verfahren.

Nachbau einer antiken Triere aus Griechenland.
Foto: PantherMedia / livadask
Spätestens mit dem Siegeszug des Imperium Romanum wurden die Menschen mobil. Die Römer bauten ein riesiges Straßennetz in Europa und Nordafrika auf. Die Seefahrt spielte in der Antike ebenfalls eine wichtige Rolle für Handel, Krieg und kulturellen Austausch. Besonders die Griechen und Römer entwickelten ausgefeilte Schiffbau-Techniken, um die Meere (und Flüsse) zu beherrschen. Ihre Konstruktionen waren an die geographischen Gegebenheiten und strategischen Anforderungen angepasst. Schauen wir uns genauer an, wie die Griechen und Römer ihrer Schiffe konstruierten. Zunächst wollen wir uns aber mit der Kartographie und die Bedeutung des Meeres in der Antike beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
Die Bedeutung des Meeres in der Antike
Das Mittelmeer war für die antiken Kulturen weit mehr als nur eine Wasserstraße – es war die Grundlage wirtschaftlicher, kultureller und militärischer Macht. Die Griechen und Römer nutzten das Meer für Handel, Expansion und Kriegsführung. Ohne ihre Seemacht hätten sie nie ihre großräumigen Netzwerke an Kolonien und Handelsrouten aufbauen können.
Das Mittelmeer war durch seine geographische Beschaffenheit ideal für die Seefahrt. Seine weitgehend geschlossene Struktur sorgte für relativ ruhige Wasserbedingungen, die den Handel erleichterten. Die unzähligen Küstenregionen mit Naturhäfen ermöglichten es, Handelswege effizient zu organisieren.
Handel und wirtschaftliche Bedeutung
Handelsstädte wie Athen, Karthago oder Alexandria wuchsen zu wirtschaftlichen Zentren heran. Besonders Getreide, Olivenöl, Wein und Metalle waren begehrte Handelswaren. Die griechischen Stadtstaaten waren stark von den Getreidelieferungen aus Sizilien, Ägypten und dem Schwarzen Meer abhängig. Römische Getreideflotten aus Nordafrika sicherten die Versorgung der Hauptstadt. Zudem ermöglichte das Meer den Austausch von Ideen, Religionen und Technologien.
Während Griechenlands Seemacht auf Stadtstaaten wie Athen und Korinth konzentriert war, bauten die Römer im Zuge der Punischen Kriege eine beeindruckende Kriegsflotte auf. Sie verstanden es, durch gezielte Seeherrschaft die Kontrolle über Handelsrouten und Küstenregionen zu sichern. Seeschlachten wurden meist nahe der Küste geführt, da eine offene Seeschlacht ohne Sicht auf das Land zu großer Desorientierung führen konnte.
Grundlagen des Schiffbau in der Antike
Die Wahl der Konstruktionsmethode beeinflusste sowohl die Stabilität als auch die Leistungsfähigkeit der Schiffe. Zwei Hauptbauweisen bestimmten den Schiffsbau: die Klinkerbauweise und die Kraweelbauweise.
Die Kraweelbauweise
Bereits seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. nutzten die alten Ägypter die Kraweelbauweise. Diese Technik bestand darin, dass Planken nicht überlappend, sondern Kante an Kante verlegt wurden. Später entwickelten griechische und römische Schiffbauer diese Methode weiter. Anstelle einer simplen Verbindung setzten sie auf eine Nut-und-Feder-Technik mit zusätzlichen Holzverzapfungen. Dadurch entstand ein elastischer, aber zugleich robuster Schiffsrumpf, der weniger Kalfaterung – also das Abdichten der Fugen – benötigte.
Zur weiteren Verstärkung erhielten viele dieser Schiffe ein zusätzliches Gerüst aus Spanten. Diese Holzbalken stützten die Plankenstruktur von innen und erhöhten die Festigkeit. Die Kraweelbauweise war besonders für größere Schiffe geeignet, da sie einen gleichmäßigen Wasserfluss entlang des Rumpfes ermöglichte und den Widerstand reduzierte.
Die Klinkerbauweise
Bei der Klinkerbauweise werden die Planken nicht direkt aneinandergefügt, sondern überlappend montiert. Dabei liegt die obere Planke stets über der darunterliegenden. Der überlappende Bereich wird als Landung bezeichnet. Um eine stabile Verbindung und Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, wird die untere Planke an dieser Stelle angeschmiegt, also schräg angehobelt. Gelegentlich wird ein Baumwollfaden zwischen den Planken eingelegt, um die Dichtigkeit weiter zu verbessern. Die Planken selbst werden durch Nieten miteinander verbunden.
Für die Spanten kommen entweder gebogene oder feste Varianten zum Einsatz. Bei festen Spanten müssen treppenförmige Aussparungen für jede Planke vorhanden sein. Durch die natürliche Holzbewegung können sich die Planken leicht gegeneinander verschieben, ohne dass sich offene Fugen bilden. Dadurch dichten Boote in Klinkerbauweise nach längerer Trockenphase schneller wieder ab als solche mit Kraweelbeplankung.
Die Entwicklung von Ruder- und Segelschiffen
Die ersten Wasserfahrzeuge im Mittelmeerraum wurden vermutlich nur mit Rudern angetrieben. Doch mit dem wachsenden Handelsaufkommen stieg die Nachfrage nach Schiffen mit mehr Stauraum. Dies führte zur Entwicklung größerer Schiffe mit Segeln. Handelssegler konnten mit Windkraft weite Strecken ökonomischer zurücklegen. Ihre Segel waren reffbar und konnten je nach Windrichtung angepasst werden.
Allerdings blieben geruderte Handelsschiffe weiterhin in Gebrauch. Sie boten vor allem bei Windstille eine zuverlässige Möglichkeit, geplante Reisezeiten einzuhalten. Zudem waren Ruder essenziell für enge Häfen oder schwierige Manöver. Kriegsschiffe nutzten eine Kombination aus Segeln und Rudern. Segel ermöglichten eine schnelle Fortbewegung über lange Distanzen, während Ruder die Wendigkeit im Kampf verbesserten.
Der Ursprung der Kriegsschiffe
Kriegsschiffe entwickelten sich aus normalen Handels- und Fischerbooten. Erste Abbildungen solcher Fahrzeuge finden sich auf ägyptischen Vasen aus dem Jahr 3400 v. Chr. Charakteristisch war die Einführung des Rammsporns, ein vorderer Verstärkungspunkt, der feindliche Schiffe rammen und beschädigen konnte. Dieses Element tauchte später auch auf assyrischen Darstellungen auf und blieb ein zentrales Merkmal antiker Kriegsflotten.
Grenzen des antiken Schiffbaus
Die Größe antiker Schiffe war durch technische Gegebenheiten limitiert. Ohne Verstärkungen aus Metall konnten Schiffe kaum länger als 40 Meter gebaut werden, da sonst die Stabilität der Konstruktion gefährdet war. Erst die Einführung von metallenen Beschlägen ermöglichte es, größere und belastbarere Schiffe zu bauen. Dies führte zu beeindruckenden Konstruktionen, die sowohl für Handel als auch für militärische Zwecke eingesetzt wurden.
Diese Schiffe bauten die Griechen
Die Griechen entwickelten zwei Haupttypen von Schiffen: Handelsschiffe und Kriegsschiffe.
Handelsschiffe
Handelsschiffe waren für den Warentransport konzipiert und zeichneten sich durch ihre breite Bauweise und große Laderäume aus. Diese Rundschiffe waren primär für Segelfahrt ausgelegt und hatten meist nur wenige Ruder für Notmanöver. Ihr Aufbau ermöglichte es, große Mengen an Handelsgütern, wie Getreide, Wein, Olivenöl und Keramik, sicher über lange Strecken zu transportieren.
Die Planken der Schiffe wurden in Karweelbauweise gefertigt, wobei sie mit Holzdübeln und Zapfen verbunden wurden. Diese Bauweise sorgte für eine hohe Stabilität. Einige Schiffe besaßen eine Kielform, die ihre Seetüchtigkeit erhöhte.
Ein besonders verbreiteter Schiffstyp war die Corbita, ein zweimastiges Handelsschiff mit großer Tragfähigkeit. Ihre Segel waren meist rechteckig und wurden mit stabilen Rahen gehalten. Ein weiteres Beispiel ist die Holkas, ein großer, schwer beladbarer Frachter mit tiefem Rumpf.
Kriegsschiffe
Die Griechen entwickelten hochspezialisierte Kriegsschiffe, die für Geschwindigkeit und Wendigkeit optimiert waren. Diese Schiffe waren deutlich schmaler und leichter als Handelsschiffe und wurden fast ausschließlich durch Ruder angetrieben. Die Segel wurden meist nur auf offenen Strecken genutzt und im Gefecht eingeholt.
Der größte Fortschritt in der griechischen Schiffbautechnik war die Entwicklung der Triere. Diese schnelle und wendige Kriegsgaleere hatte drei gestaffelte Ruderreihen auf jeder Seite. Sie war etwa 40 Meter lang und ermöglichte durch ihre Leichtbauweise eine höhere Geschwindigkeit als frühere Schiffstypen. Die Triere konnte von bis zu 170 Ruderern angetrieben werden, die in perfekter Synchronisation arbeiteten.
Bauweise und Technik:
- Der Rumpf der Trieren bestand aus leichten, aber stabilen Planken, die mit Zapfen- und Nutverbindungen verstärkt wurden.
- Der Kiel verlieh dem Schiff strukturelle Festigkeit und half bei der Steuerung.
- Zwei seitlich angebrachte Steuerpaddel wurden zur Kurskorrektur genutzt.
- Der Bug war mit einem massiven Rammsporn (Epibole) ausgestattet, mit dem feindliche Schiffe gezielt gerammt und zum Kentern gebracht werden konnten.
Organisation der Ruderer: Um eine höchstmögliche Effizienz zu gewährleisten, wurden die Ruderer streng organisiert:
- Sie saßen in drei gestaffelten Reihen: Thraniten (obere Reihe), Zygiten (mittlere Reihe) und Thalamiten (untere Reihe).
- Ein Keleustes (Rhythmusgeber) sorgte durch Rufe oder Trommelschläge dafür, dass die Ruder synchronisiert wurden.
- Ein Trierauletes (Flötist) spielte oft eine Melodie zur Taktgebung.
Weitere Kriegsschiffe: Neben der Triere gab es auch kleinere und größere Varianten:
- Bireme: Mit zwei Ruderreihen, Vorläufer der Triere.
- Pentekonter: Ein langes, schmal gebautes Schiff mit 50 Ruderern, das vor allem für schnelle Angriffe verwendet wurde.
- Quadrireme und Quinquereme: Spätere Weiterentwicklungen mit vier oder fünf Ruderreihen, die mehr Kampfkraft boten.
Die griechischen Kriegsschiffe dominierten das Mittelmeer für Jahrhunderte und waren der Schlüssel zu den Siegen Athens in den Perserkriegen und des Delischen Seebunds. Ihr Erfolg beruhte nicht nur auf ausgeklügeltem Design, sondern auch auf disziplinierter und effizienter Rudertechnik.

Rekonstruktion eines römischen Schiffes im Unterwassermuseum Bodrum.
Foto: PantherMedia / Mutan7
Diese Schiffe bauten die Römer
Die Römer übernahmen viele Elemente des griechischen Schiffbaus, entwickelten sie jedoch weiter. Sie passten ihre Schiffe den spezifischen Anforderungen der Kriegsführung, des Handels und der Flussschifffahrt an.
Römische Kriegsschiffe
Römische Triremen und Biremen basierten auf griechischen Vorbildern, wurden aber für römische Militärtaktiken modifiziert. Eine der bedeutendsten Neuerungen war die Enterbrücke (Corvus), die es ermöglichte, feindliche Schiffe direkt zu entern und den Kampf auf das Deck zu verlagern. Dies veränderte die Kriegsführung zur See grundlegend, da die Römer weniger auf die rammende Taktik angewiesen waren, sondern auf Entergefechte setzten, in denen sie ihre Überlegenheit als Infanterie demonstrierten.
Größere römische Kriegsschiffe waren oft mit mehreren Decks ausgestattet, um Platz für Soldaten, Bogenschützen und Artillerie wie Katapulte und Ballisten zu schaffen. Die Steuerung erfolgte durch zwei große Steuerruder am Heck, die mit stabilen Lederriemen befestigt waren und ein hohes Maß an Wendigkeit ermöglichten.
Spätere römische Kriegsschiffe entwickelten sich zu größeren Mehrreiherschiffen wie Quadriremen (vier Ruderreihen) und Quinqueremen (fünf Ruderreihen). Diese Schiffe waren schwerer bewaffnet und boten mehr Schutz für die Besatzung.
Handelsschiffe der Römer
Römische Handelsschiffe wurden für den Transport großer Warenmengen optimiert und waren in der Regel größer als ihre griechischen Gegenstücke. Sie besaßen robuste Rümpfe, um schwere Lasten zu tragen, und eine fortschrittliche Takelage, die effizientes Segeln ermöglichte.
Ein bekanntes Beispiel ist die „Alexandreia“, ein riesiges Getreideschiff, das bis zu 1000 Tonnen Ladung transportieren konnte. Diese Schiffe waren essenziell für die Versorgung der römischen Hauptstadt mit Getreide aus Nordafrika, Sizilien und Ägypten. Sie besaßen mehrere Masten mit großen viereckigen Segeln, die durch Rahen stabilisiert wurden.
Weitere wichtige Handelsschiffe waren:
- Corbita: Ein zweimastiges Schiff, das für den Transport von Wein, Olivenöl und Getreide genutzt wurde.
- Oneraria: Ein vielseitiges Frachtschiff mittlerer Größe, das für kurze und mittlere Handelsrouten diente.
- Actuaria: Ein schnelles, leichtes Frachtschiff, das sowohl mit Segeln als auch mit Rudern betrieben wurde.
Die Handelsrouten der Römer erstreckten sich nicht nur über das Mittelmeer, sondern auch entlang der Küsten des Atlantiks und bis nach Britannien.
Binnenschifffahrt der Römer
Neben der Seeschifffahrt spielten Flüsse eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche und militärische Infrastruktur des Römischen Reiches. Die Römer nutzten Flussschiffe für den Transport von Waren, Truppen und Baumaterialien.
Wichtige Flüsse für die römische Binnenschifffahrt waren:
- Der Rhein: Haupttransportweg für Militär und Handel in den nördlichen Provinzen.
- Die Donau: Eine zentrale Handelsroute für Getreide und Rohstoffe aus den Provinzen Pannonien und Dakien.
- Der Tiber: Der wichtigste Fluss für die Versorgung Roms mit Lebensmitteln und Baumaterialien.
- Die Rhône und die Seine: Handelswege, die Gallien mit dem Mittelmeer verbanden.
Die Binnenschiffe waren meist flachbodig, um auch niedrige Wasserstände bewältigen zu können. Ein typisches Flussschiff war die Navis Lusoria, ein leichtes Patrouillenschiff, das sowohl für Transport- als auch für Militärzwecke genutzt wurde. Größere Frachtschiffe, wie die Celtic Barges, transportierten schwere Lasten über weite Strecken.
Brücken und Hafenanlagen entlang der Flüsse wurden oft durch römische Ingenieure errichtet, um einen reibungslosen Warenfluss zu gewährleisten. Viele dieser Infrastrukturprojekte bestehen bis heute und zeugen von der Effizienz der römischen Binnenschifffahrt.
Seefahrt und Navigation in der Antike
Die Navigation war für die antiken Seefahrer eine komplexe Herausforderung, da sie ohne moderne Hilfsmittel wie den Magnetkompass oder genaue Seekarten auskommen mussten. Trotzdem entwickelten Griechen und Römer ausgeklügelte Techniken, um auf hoher See und entlang der Küsten zu navigieren.
Orientierung durch Himmelskörper
Die wichtigste Methode zur Navigation war die Orientierung an der Sonne, den Sternen und den Planeten. Besonders der Polarstern (in der Antike dem Sternbild Drache zugeordnet) diente als fixer Bezugspunkt zur Bestimmung der geografischen Breite.
- Tagsüber richteten sich die Seefahrer nach dem Sonnenstand, um ihre Fahrtrichtung zu prüfen.
- Nachts nutzten sie Sternbilder wie den Großen Wagen, um ihre Route zu korrigieren.
Navigationsinstrumente
Obwohl die technischen Hilfsmittel begrenzt waren, verwendeten antike Seefahrer einige grundlegende Instrumente:
- Gnomon: Eine Art Sonnenuhr zur Bestimmung der Tageszeit und des Breitengrads.
- Lot (Blei- oder Steingewichte mit Seilen): Zum Messen der Wassertiefe und zur Einschätzung des Untergrunds.
- Periploi (Seefahrtsanleitungen): Geschriebene Wegbeschreibungen, die Küstenverlauf, Hafenstandorte und markante Orientierungspunkte enthielten.
Winde und Strömungen
Die Kenntnis von Wind- und Meeresströmungen spielte eine entscheidende Rolle für die Navigation. Die Griechen und Römer wussten, dass beständige Winde wie die Etesien (Sommerwinde im östlichen Mittelmeer) genutzt werden konnten, um Reisen zu beschleunigen. Zudem waren sie sich der Gefahren von Strömungen bewusst, etwa in der Meerenge von Messina, wo starke Gezeitenströme täglich wechselten.
Küstennavigation und offene Seefahrt
Da offene Seewege riskant waren, folgten die meisten Schiffe den Küstenlinien und machten regelmäßig in sicheren Häfen Halt. Landmarken, wie hohe Berge oder auffällige Felsen, halfen bei der Orientierung.
- Häfen wie Puteoli, Ostia oder Alexandria waren strategisch wichtige Zwischenstopps für Langstreckenreisen.
- Die wenigen Hochseereisen wurden bevorzugt zur Sommerzeit unternommen, wenn das Wetter stabiler war.
Fehlende Zeitmessung und Geschwindigkeitsbestimmung
Ein großes Problem war die fehlende exakte Zeitmessung. Während in der Antike Wasseruhren (Klepshydren) zur Abschätzung von Zeitspannen verwendet wurden, gab es keine Methode, um die Geschwindigkeit eines Schiffes genau zu bestimmen.
- Entfernungen wurden oft in Tagesreisen angegeben.
- Erfahrungswerte halfen den Steuermännern, anhand von Windgeschwindigkeit und Strömung eine ungefähre Geschwindigkeit zu ermitteln.
Navigationsfehler und Gefahren
Trotz aller Techniken war die Navigation fehleranfällig. Ungenaue Karten, Wetterumschwünge oder plötzliche Nebelbänke konnten zur Orientierungslosigkeit führen. Besonders berüchtigt war die Passage zwischen Sizilien und Italien, wo die Strudel von Charybdis und die Klippen von Skylla die Seefahrer herausforderten.
Leuchttürme als Hilfsmittel
Um die Navigation sicherer zu gestalten, errichteten die Römer Leuchttürme an wichtigen Hafeneinfahrten:
- Der Leuchtturm von Alexandria (Pharos) war mit über 100 Metern eines der beeindruckendsten Bauwerke der Antike.
- Weitere Leuchttürme standen an der Küste Spaniens, in Britannien und an der römischen Nordseeküste.
Ein Beitrag von: