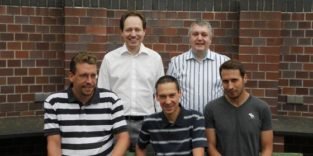Neue Erkenntnisse zur Korrosion von Magnesium-Legierungen
Chirurgen arbeiten heute mit Magnesium-Implantaten, um Knochenbrüche zu stabilisieren oder um Blutgefäße offenzuhalten. Wie sich dieses Metall im Körper abbaut, haben Schweizer Materialwissenschaftler jetzt untersucht.

Forscher der ETH Zürich haben untersucht, wie bioresorbierbare Implantate abgebaut werden.
Foto: ETH Zürich
In der modernen Medizin haben Magnesiumlegierungen ihren festen Platz erobert. Sie stabilisieren als Schrauben oder Platten komplizierte Knochenbrüche. Und kleine Gefäßstützen, sogenannte Stents, halten Gefäße offen, etwa nach einem Herzinfarkt. Das Material hat einen entscheidenden Vorteil. Es wird vom Körper langsam abgebaut und aufgenommen, sprich resorbiert. Folge-Operationen, um Materialien nach Abschluss der Heilung zu entfernen, sind nicht mehr nötig. Das senkt mögliche Risiken und spart Geld. Außerdem unterstützt Magnesium das Wachstum von Knochen.
Doch was geschieht im Körper genau? Dieser Frage gingen Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich jetzt nach. Ihnen gelang es, Abbauprozesse auf einer Nanoskala zu beobachten. Ihr langfristiges Ziel ist es, Implantatwerkstoffe zu entwickeln, deren Resorption besser steuerbar ist.
Nicht jede Legierung ist geeignet
Zu Beginn stellten sich ETH-Wissenschaftler die Frage, welches Material die besten Ergebnisse liefert. Reines Magnesium ist bekanntlich zu weich. Es werden Legierungen benötigt. Setzt man seltene Erden wie Yttrium und Neodym zu, verbessern sich zwar die mechanischen Eigenschaften. Allerdings reichern sich solche Legierungsbestandteile im Körper an, weil sich nur Magnesium zersetzt. Die Folgen sind aus toxikologischer Sicht bislang unklar.
Deshalb gingen die ETH-Forscher einen anderen Weg. Sie entwickelten für ihre Experimente Legierungen aus Magnesium mit weniger als einem Prozent Kalzium und Zink, um die erforderliche Härte zu erreichen. Ihre Zusätze sind ebenfalls biokompatibel und werden vom Körper aufgenommen.
Die Transmissionselektronenmikroskopie liefert Details zum Abbau
Damit hatten sie zumindest eine erste Hürde genommen. Offen blieb jedoch, wie sich ihr neues Material unter physiologischen Bedingungen verhält. Deshalb brachten die Wissenschaftler Proben in eine Flüssigkeit, um physiologische Bedingungen im Körper zu simulieren. Was dabei passierte, beobachteten sie mit der analytischen Transmissionselektronenmikroskopie (TEM). Mit Elektronenstrahlung kann man die Konzentration und Verteilung chemischer Elemente im Objekt präzise bestimmen – und zwar in einer Auflösung von wenigen Nanometern.
Im Labor stellte die ETH-Arbeitsgruppe Überraschendes fest. Es kam nämlich zur sogenannten Entlegierung (Dealloying): Kalzium und Magnesium oxidierten im physiologischen Milieu zu den entsprechenden Ionen und gingen in Lösung. Zink hingegen reicherte sich an, sodass die Legierung laufend ihre elektrochemischen Eigenschaften veränderte. Dieser Prozess schien die weitere Korrosion zu beschleunigen.
Neue Legierungen für die Praxis entwickeln
„Unsere Erkenntnis stößt ein Dogma um“, erklärt Jörg Löffler von der ETH Zürich. „Bisher nahm die Forschung nämlich an, dass die chemische Zusammensetzung der Ausscheidungsphasen in Magnesiumlegierungen während der Korrosion unverändert bleibt.“ Dies habe zu falschen Prognosen des Abbauverhaltens geführt. Und Martina Cihova, Doktorandin bei Löffler, ergänzt: „Der von uns beobachtete Mechanismus scheint universell zu sein, und wir gehen davon aus, dass er sowohl in anderen Magnesiumlegierungen als auch in anderen aktiven Materialien mit intermetallischen Ausscheidungen auftritt.“
Diese Erkenntnis könnte Herstellern helfen, je nach Zielgruppe, unterschiedliche Legierungen herzustellen. Beispielsweise werden Implantate im Körper von Kindern schneller abgebaut als bei Erwachsenen, was nicht immer wünschenswert ist. Und Schrauben sollen generell rascher zerfallen als Stents, die ein Blutgefäß ein bis zwei Jahre offenhalten. Löffler plant jetzt Experimente in vitro, um die Übertragbarkeit der Resultate zu testen.
Magnesium mit strukturierter Porosität – per 3D-Druck
Dabei kann er auf eigene Vorarbeiten zurückgreifen. Vor wenigen Monaten gelang es Löffler und seinem Team, Implantate mit poröser Grundstruktur zu entwickeln. Per 3D-Druck produzierten sie ein dreidimensionales Gittergerüst. Als Tinte kam eine speziell entwickelte Salzpaste zum Einsatz. Der Durchmesser der Gitterstreben und deren Abstand lässt sich variieren. Um die Salzstruktur zu festigen, wurde sie anschließend gesintert, also nach einem bestimmten Verfahren erhitzt. Danach gossen sie metallisches Magnesium in die Poren. Das Salzgerüst blieb stabil und wurde schließlich mit Wasser herausgelöst.
Der Rohling selbst hat regelmäßig angeordneten Poren. Er lässt sich mechanisch in die gewünschte Form bringen. Knochenbildende Zellen wachsen in diese Hohlräume hinein. Die Implantate lösen sich dabei auf, und ein komplizierter Knochenbruch heilt schneller.
Mehr zum Thema Implantate aus Metallen
Ein Beitrag von: