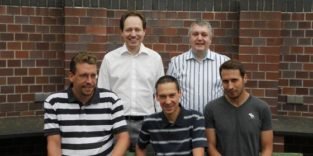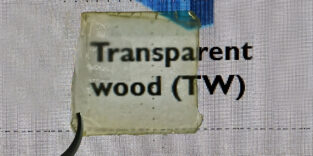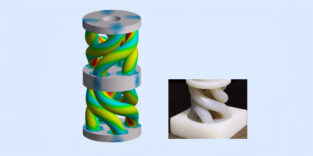Von Kaolin, Feldspat und Quarz zum weißen Gold
Zahnersatz, Isolatoren oder Geschirr – seine herausragenden Eigenschaften machen Porzellan so wertvoll. Das Museum Reich der Kristalle in München hat dem Material eine Sonderausstellung (bis zum 2. 6. 13) gewidmet. Im Mittelpunkt stehen Geschichte, Entwicklung und technische Anwendungen des Werkstoffs. Daneben zeigen ausgesuchte Einzelstücke die Handwerkskunst zweier berühmter deutscher Porzellan-Manufakturen.

Porzellan eignet sich nicht nur als Geschirr. Das Museum Reich der Kristalle in München hat dem wertvollen Werkstoff nun eine Sonderausstellung gewidmet.
Foto: dpa-Zentralbild
Der Mann ist schon lange tot, aber sein Name ist Experten ein Begriff: Johann Friedrich Böttger, geboren 1682 im thüringischen Schleiz, war einer der wichtigsten Akteure in der Entwicklung des europäischen Porzellans, und deshalb ist seine Geschichte Bestandteil der Sonderausstellung im Museum Reich der Kristalle in München. Der Apothekerlehrling behauptete frech, er könne Gold aus Silbermünzen herstellen. Als dies dem Monarchen August der Starke und dem Preußenkönig Friedrich I. zu Ohren kam, entbrannte ein Wettstreit zwischen ihnen, aus dem der Sachse als Sieger hervorging. Er ließ den jungen Mann entführen und steckte ihn im Jahr 1704 in ein Labor mit dem Naturforscher Ehrenfried Walther von Tschirnhaus.
Die Rohstoffe, mit denen die beiden Herren experimentierten, sind in einem der Schaukästen exemplarisch abgebildet: Das feinkörnige Gestein, das wie Kreide aussieht, ist das seltene Kaolin (auch Tonerde genannt). Es handelt sich um ein weißes Mineral, das entsteht, wenn Feldspat verwittert. Letzterer liegt in der Erdkruste in kristalliner, typisch säulenartiger Form vor und kann weiß, rosa, grün oder braun sein. Dieses Mineral sorgt für die chemische Beständigkeit des Endprodukts. Der dritte Rohstoff, der glasförmige Quarz, verleiht dem Porzellan seine Festigkeit.
Das von den beiden Deutschen entwickelte Verfahren hört sich simpel an: Man nehme Kaolin plus Feldspat plus Quarz, vermahle das Ganze, setze Flüssigkeit hinzu, bis eine Masse (der so genannte Schlicker) entsteht, die man in eine hohle Form aus Gips gießt. Letztere entzieht der Masse das Wasser, und deren festen Bestandteile lagern sich an den Wänden der Form an. Je länger die Masse in der Form bleibt, um so dicker die Schicht, die sich an der Grenzfläche absetzt. So bald die gewünschte Dicke erreicht ist, wird der Rest der Masse aus der Form gegossen. Nach einer gewissen Wartezeit wird die Form geöffnet, der Rohling kann trocken und anschließend bei rund 950 °C gebrannt werden (Sprühbrand). Dann folgen die Glasur und ein zweiter Brand bei noch höheren Temperaturen (Glattbrand).
Doch bis aus den kristallinen Pulvern das „weiße Gold“ entstand, waren viele Versuche notwendig. Die Experimentatoren mussten nicht nur das optimale Mischungsverhältnis der Rohstoffe herausfinden, sondern ebenso geeignete Öfen entwickeln, die sich auf Temperaturen bis zu 1400 °C hochheizen ließen und das richtige Brennen (sogenannte Sinterung) lernen. Zu guter Letzt hatten sie sich auch mit den Glasuren zu beschäftigen.
„Die beiden Deutschen haben das Porzellan in Europa praktisch neu erfunden“, stellt Museumsleiter Rupert Hochleitner fest. Ihre (ingenieurtechnische) Leistung bestand in der ausgeklügelten Gestaltung und Abstimmung der einzelnen Prozessschritte. Denn beim Glattbrand schrumpft der Rohling – die Vase in einer der Museumsvitrinen ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel. Um eine gleichbleibende Qualität der Produkte zu erreichen, ist es wichtig, eine genaue Rezeptur zu haben sowie Ofentemperatur und Brennatmosphäre exakt einzustellen. Durch Variation der Bestandteile und Beimischungen lassen sich außerdem die Eigenschaften des Porzellans verändern.
Mit der Industrialisierung im 20. Jahrhundert und Rationalisierung der Prozesse fanden Produkte wie Geschirr nicht nur in besser gestellten, sondern auch in Durchschnittshaushalten Verwendung. Auch die Industrie, wie die Schau verdeutlicht, und hier allen voran die Elektrotechnik, wusste, die guten Eigenschaften des Materials zu schätzen. Porzellan hat eine hohe mechanische Festigkeit, ein hohes elektrisches Isoliervermögen, ist verschleißfest, hitze- und korrosionsbeständig.
Heute noch werden für Hochspannungsleitungen oder oberirdische Telefonmasten Isolatoren aus Porzellan verwendet. Zündkerzen sind ohne den Werkstoff undenkbar – genauso wie die Hitzeschilde von Raumfahrzeugen. Auch Laborzubehör besteht aus dem Material, denn es reagiert nicht mit anderen chemischen Substanzen. Außerdem ist es biologisch kompatibel – letzteres kann jeder bestätigen, der eine Keramikfüllung in seinem Gebiss hat.
Auch über die Geologie der Ausgangsstoffe erfährt der Besucher Wissenswertes: „Oberfranken und die Oberpfalz sind wie geschaffen für die Porzellanherstellung, alle drei Rohstoffe kommen dort vor. Deshalb ist nicht verwunderlich, dass einige der größten Porzellan-Produzenten ihren Sitz dort hatten“, klärt Rupert Hochleitner auf. Die Region Ostbayern brachte Werke hervor wie Arzberg, Hutschenreuther, Mitterteich, Rosenthal, Selb in Weiden oder Tirschenreuth. Heute existiert bei den meisten Herstellern nur noch der Markenname, produziert werden die Waren in Asien.
Weitere Schaukästen erfreuen die Liebhaber chinesischen Porzellans oder von Fayence-Geschirr. Exponate und Bilder klären über die Besonderheiten dieser „Schulen“ auf. Zu den Höhepunkten der Ausstellung zählen die in Vitrinen ausgestellten Bergmannsfiguren aus der Meißener (Dresden) und der Nymphenburger (München) Werkstatt. Wer die handbemalten Stücke genau studiert, erkennt den charakteristischen Stil der beiden weltbekannten, deutschen Manufakturen: Auf der einen Seite die barocken sächsischen Arbeiten, bei denen der runde Bauch der Akteure vom damaligen Wohlstand kündet. Auf der anderen Seite die feingliedrigen Figuren der Nymphenburger, die das Handwerk zur Kunst erkoren. EVDOXIA TSAKIRIDOU
Ein Beitrag von: