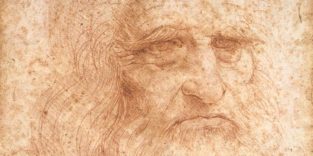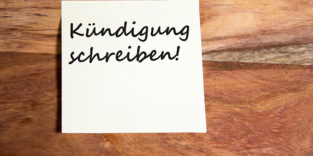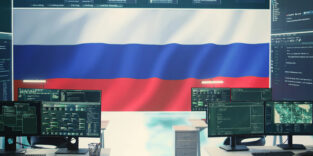Emissionshandel: Ab 2027 drohen Hammerpreise an der Zapfsäule
Ab 2027 könnten die Spritpreise um bis zu 19 Cent pro Liter steigen. Grund ist die Reform des Emissionshandels. Was das bedeutet und welche Entlastungen gefordert werden.

Der Bundesrat befasst sich mit einer Reform des Emissionshandels. Das klingt technisch - kann aber spürbare Folgen für Verbraucher haben und die Spritpreise in die Höhe treiben.
Foto: PantherMedia / Heidrun Hobel
Autofahrende müssen sich ab 2027 auf erhebliche Preissteigerungen an der Tankstelle einstellen. Grund dafür ist die geplante Reform des Emissionshandels in der EU. Laut ADAC könnte der CO2-Preis deutlich stärker steigen als in den Jahren zuvor. „Ähnlich wie in diesem Jahr gehen wir für 2026 von einem Preisanstieg von maximal 3 Cent bei Benzin und 3,1 Cent beim Diesel aus“, erklärte ADAC-Präsident Christian Reinicke gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ab 2027 erwartet der Automobilclub jedoch jährliche Steigerungen von bis zu 19 Cent pro Liter, abhängig davon, wie sich der Markt entwickelt und welche klimapolitischen Maßnahmen ergriffen werden.
Warum steigen die Preise?
Hintergrund dieser Entwicklung ist die Reform des Emissionshandels. Der CO2-Preis wird derzeit in Deutschland über das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) geregelt. Seit Januar 2024 liegt der Preis bei 55 € pro Tonne CO2. Nach den aktuellen Planungen steigt der Höchstpreis für Emissionszertifikate bis 2026 auf 65 €.
Ab 2027 soll dann das europäische Emissionshandelssystem (ETS) greifen. Im Gegensatz zum bisherigen nationalen System wird der Preis für CO2-Zertifikate dann nicht mehr von der Regierung festgelegt, sondern durch den Marktmechanismus bestimmt. Dadurch könnten sich die Kosten für fossile Brennstoffe erheblich verteuern, insbesondere wenn die Nachfrage nach Emissionszertifikaten hoch bleibt.
Wie funktioniert der Emissionshandel?
Das Emissionshandelssystem basiert auf dem Prinzip, dass Unternehmen Zertifikate für jede ausgestoßene Tonne CO2 erwerben müssen. Diese Zertifikate werden an der Börse gehandelt, wobei die Preise je nach Angebot und Nachfrage variieren.
Bislang war der Emissionshandel auf die Industrie und den Energiesektor beschränkt. Ab 2027 wird er jedoch auf den Verkehrssektor und die Gebäudeheizung ausgeweitet. Das bedeutet, dass Tankstellenbetreiber und Heizölhändler ebenfalls CO2-Zertifikate kaufen müssen, was die Kosten für Kraftstoffe und Heizenergie weiter in die Höhe treiben könnte.
ADAC fordert Entlastungen
Trotz grundsätzlicher Zustimmung zum Emissionshandel fordert der ADAC Maßnahmen zur Abmilderung der finanziellen Belastung. Viele Menschen sind auf ihr Auto angewiesen und können nicht einfach auf klimafreundliche Alternativen wie Elektrofahrzeuge oder öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.
„Die Politik muss den ab 2027 steigenden CO2-Preis verlässlich und wirksam abfedern“, so Reinicke. Er fordert insbesondere ein sogenanntes Klimageld, um Verbraucherinnen und Verbraucher mit geringem Einkommen zu entlasten. Zudem sollte die Pendlerpauschale dauerhaft erhöht werden, um insbesondere Berufspendler nicht unverhältnismäßig zu belasten.
Auch Energieversorger warnen
Nicht nur Autofahrende sind betroffen, sondern auch die Energiebranche sieht wirtschaftliche Risiken. Kerstin Andreae, Vorsitzende des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), betont: „Entscheidend ist, dass die Bundesregierung sicherstellt, dass die Einnahmen aus dem Emissionshandel auch vollständig für die zielgerichtete Entlastung von betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern verwendet werden.“
Dazu gehörten neben dem Klimageld auch Zuschüsse für energetische Gebäudesanierungen. Insbesondere Haushalte mit niedrigen Einkommen könnten sonst durch steigende Heizkosten stark belastet werden.
Klimaschutz als Ziel
Das Hauptziel des Emissionshandels ist es, den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren und die Klimaziele der EU einzuhalten. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden. Höhere CO2-Kosten sollen Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen dazu motivieren, auf klimafreundliche Technologien umzusteigen. Das betrifft nicht nur den Verkehrssektor, sondern auch die Gebäudeheizung und die Industrie.
Ein weiteres Problem ist die Unsicherheit über die zukünftigen CO2-Preise. Die Energiebranche befürchtet, dass sie bereits langfristige Verträge abschließen muss, ohne genau zu wissen, welche Kosten sie ab 2027 erwarten. Laut Andreae stellt dies ein erhebliches wirtschaftliches Risiko dar. Ein plötzlicher Preissprung könnte dazu führen, dass Energieversorger die Mehrkosten nicht rechtzeitig an die Kunden weitergeben können und so unter finanziellen Druck geraten. (mit dpa)